
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
Grundeinkommen als neoliberales Befriedungskonzept? Eine Erwiderung MALMOE hat mich freundlicherweise dazu eingeladen, ein paar Zeilen zum bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) zu verfassen. Vorweg: Was ein Grundeinkommen ist, wird von den BefürworterInnen einhellig und klar definiert. Es muss vier Kriterien entsprechen: „allgemein: alle BürgerInnen, alle BewohnerInnen des betreffenden Landes müssen tatsächlich in den Genuss dieser Leistung kommen; existenzsichernd: die zur Verfügung gestellte Summe soll ein bescheidenes, aber dem Standard der Gesellschaft entsprechendes Leben, die Teilhabe an allem, was in dieser Gesellschaft zu einem normalen Leben gehört, ermöglichen; personenbezogen: jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hat ein Recht auf Grundeinkommen. Nur so können Kontrollen im persönlichen Bereich vermieden werden und die Freiheit persönlicher Entscheidungen gewahrt bleiben; bedingungslos soll das von uns geforderte Grundeinkommen deshalb sein, weil wir in einem Grundeinkommen ein BürgerInnenrecht sehen, das nicht von Bedingungen (Arbeitszwang, Verpflichtung zu gemeinnütziger Tätigkeit, geschlechterrollenkonformes Verhalten, etc.) abhängig gemacht werden kann.“ (1) Bisherige existenzsichernde Transferleistungen wie Studienbeihilfen, Ausgleichszulage, Arbeitslosen- und Notstandhilfe können entfallen, hingegen muss die Kranken- und Unfallversicherung beibehalten werden. Da die Finanzierung bedeutende Finanzmittel erfordert, ist in jedem Fall eine massive Erhöhung der Steuern auf Profite und Eigentum unumgänglich, wobei die Schließung von Steuerschlupflöchern Vorbedingung ist. Unter anderem wurde ich gefragt, was ich zu der auch in manchen linken Kreisen vertretenen Kritik sagen würde, dass das Grundeinkommen ein neoliberales Konzept sei, dass es den Unternehmen diene, Leute mit niedrigen Einkommen quasi abspeist und befriedet. Mythen zu widerlegen macht durchaus Freude und ich beginne mit den finanziellen Dimensionen, die ein Grundeinkommen erfordern würde. Vorweg ein paar budgetäre Größen: Das Bruttoinlandsprodukt beträgt rund 330 Milliarden, das Bundesbudget um die 85 Milliarden. Die aktuellen Sozialausgaben betragen ohne Sachleistungen 80, mit Sachleistungen 100 Milliarden. (2) Ein BGE von 1100 Euro im Monat erfordert rund 105 Milliarden. Eine Ersetzung des bisherigen Sozialstaates durch ein BGE würde somit den Finanzbedarf erhöhen, statt zu senken. Markus Marterbauer hatte da ein weiteres, interessantes Argument gegen das BGE auf Lager.(3) Während, so seine Argumentation, die 80 Milliarden monetärer Sozialausgaben treffsicher verwendet würden, würde es als BGE zu einem blinden Gießkannenprinzip führen. Der gute Mann hatte allerdings vergessen, dass ein möglicher neoliberaler Kahlschlag im Sozialsystem auch die Einnahmen vernichten würde. Ohne Pension, Arbeitslose und Notstandhilfe auch keine Beiträge zur Sozialversicherung. Die aktuellen Sozialausgaben werden nämlich zu rund 65 % aus den Beiträgen der Versicherten und nur zu 35 % aus Budgetmitteln finanziert. Wird das geltende Sozialsystem neoliberal beseitigt, so bleiben bloß rund 28 Milliarden Steuergelder zur Verteilung. Ein damit finanziertes BGE würde gerade 275 Euro pro Kopf und Nase ergeben. Es gäbe dann keine Pension, keine Krankenversicherung, kein Arbeitslosengeld und keine Mindestsicherung mehr. Bei allem Pessimismus, das halte ich für nicht durchsetzbar. Schlussfolgerung: Selbst ein äußerst bescheidenes Grundeinkommen erfordert einen höheren Finanzbedarf als das gegenwärtige System. Was nun die mögliche Lohnsubvention durch das BGE betrifft, so ist erstmals festzuhalten: Es gibt schon jetzt offene, direkte Lohnsubventionen. Die Aktion 20.000 will ebenso viele Arbeitsplätze schaffen, 778 Millionen Euro sind dafür reserviert. Bis zu 100 % der Lohnkosten können vom AMS übernommen werden. Diese Maßnahme setzt die bisherige Praxis des AMS fort. Hinzu kommen die indirekten Lohnsubventionen wie Vergünstigungen, Steuernachlässen, Grundstücksschenkungen bei Betriebsgründungen oder Investition. Mir ist kein Sterbenswörtchen Kritik unserer linken BGE-KritikerInnen an dieser Art der Lohnsubventionen bekannt. Zweifellos könnte es bei Einführung des BGE in bestimmten Bereichen mit interessanten und befriedigenden Arbeiten de facto zu Lohnsubventionen kommen. Und, was ist daran so problematisch? Was ist so schlimm, wenn Menschen mehr Geld dank BGE zur Verfügung haben als ohne? Man muss sich das Gegenargument auf der Zunge zergehen lassen: Die Menschen würden zufrieden sein und nicht mehr rebellieren – als ob sie das jetzt so massenhaft täten. Na klar, je mehr die Menschen von Existenzängsten geplagt sind, je mehr sie sich um ihr Auskommen sorgen, je mehr sie den Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze führen müssen, desto rebellischer werden sie. Geht‘s noch? Die aktuellen Formen der Lohnsubvention machen das AMS und die Unternehmungen zu bestimmenden Akteuren, die Erwerbsarbeitslosen zu passiven Objekten. Ist das in Ordnung, werte KritikerInnen? Ein BGE hingegen würde Entscheidungen in die Hände der LohnempfängerInnen legen. Sie könnten sich aussuchen, ob und zu welchen Bedingungen sie auch gering bezahlte Lohnarbeit annehmen. Selbstermächtigung lautet das Zauberwort. (1) Siehe Defintion auf www.grundeinkommen.at (2) Die Zahlen sind ungefähre Angaben, die Daten stammen entweder aus der Webseite der Statistik-Austria oder der Informationsbroschüre des Sozialministeriums Sozialstaat Österreich. Leistungen, Ausgaben und Finanzierung 2016. (3) Es handelt sich um einen älteren Text im Falter vom 3. Februar 2017. online seit 19.02.2018 11:13:36 (Printausgabe 81) autorIn und feedback : Karl Reitter |
|
Feministische Ökonomie #4 Realitätsferne Utopien nützen der Sache! [07.03.2018,Dr. Ingo Schneepflug] Wie fair ist Erben? Warum die Erbschaftssteuer keine Mehrheit findet [19.02.2018,Pinguin] Feministische Ökonomie #3 Türkis-blaue Heimat, Familie und Edelweiß am Revers [19.02.2018,Dr. Ingo Schneepflug] die vorigen 3 Einträge ... die nächsten 3 Einträge ... |
||||
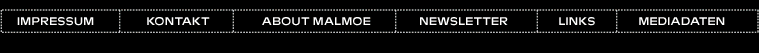 |