
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
Do the Mutant Dance Tim Lawrence erweitert sein monumentales Projekt einer Chronik der US-amerikanischen Danceculture um ein weiteres Buch: „Life and Death on the New York Dance Floor, 1980 – 1983“. Eigentlich wollte der Kulturwissenschafter und Dancefloor-Aktivist Tim Lawrence eine andere Geschichte erzählen. Und zwar jene der Entstehung von House-Music und Techno in den USA der 1980er. Als junger Student hatte er in Manchester 1988 den sogenannten zweiten „Summer of Love“ erlebt, als Acid House einen Paradigmenwechsel in der englischen Clubszene einläutete. Das Studium diente als Vorwand, in seine Sehnsuchts-Stadt New York zu ziehen und das dortige Clubleben zu erforschen. Als er dabei auf den damals nur Eingeweihten bekannten Disco-Pionier David Mancuso traf, war’s um ihn geschehen. Der leider diesen November verstorbene Mancuso lieferte mit den Partys, die er ab 1970 in seinem eigenen Loft veranstaltete, den Blueprint für alles ab, was später die Club-Kultur definieren sollte. Für zahlreiche stilprägende DJs wie Larry Levan, Nicky Siano und Frankie Knuckles war das Loft der Einstieg in eine neue, faszinierende Welt. Der intime Rahmen, der nur jenen mit Einladung Zugang gestattete, und das völlig auf das Tanzen abgestellte audiophile Konzept Mancusos garantierte einen wertschätzenden Umgang unter den Besucher_innen, die offen für jede sexuelle Orientierung waren, und bei dem die Hautfarbe keine Rolle spielte. Die Archive des Ephemeren Lawrence begriff schnell, dass er hier auf die ungeschriebene Geschichte der Disco-Bewegung in Manhattan gestoßen war und weitete seinen Forschungsgegenstand konsequenterweise auf die 1970er und die Entstehung von Disco aus. Das Ergebnis ist das 2003 erschienene „Love Saves The Day“, wahrscheinlich das beste Buch, das jemals über Dance Culture geschrieben wurde. Lawrence führte über Jahre hinweg Gespräche mit mehr als hundert Protagonist_innen der Szene. Seien es DJs, Musiker_innen, Club-Betreiber_innen, aber auch Tänzer_innen und all jene, die nie im Rampenlicht stehen, aber mit ihrer Leidenschaft im Hintergrund der Clubs oder auf der Tanzfläche dafür sorgen, dass die Dinge in Bewegung geraten. Dazu fand er Zugang in die privaten Archive der Gesprächspartner_innen. Aus all diesen Quellen zieht Lawrence seine eigenen Schlüsse und erzählt eine spannende und höchst komplexe Geschichte mit vielen Querverbindungen. Der mit allen Wassern der Cultural Studies gewaschene Tim Lawrence bettet seine Erzählungen soziographisch ein, und so lesen sich seine Texte auch als Studie zur postindustriellen Stadtenwicklung. Natürlich spielen auch die politischen Identitäts-Kämpfe dieser Zeit und das Erwachen der LGBT-Bewegung eine große Rolle. Lawrence bezieht sich hier u. a. auf den kubanischen Queer-Theoretiker José Esteban Muñoz und dessen Konzept des Archivs des Ephemeren. Während bestimmte Formen künstlerischer Tätigkeit wie Tonaufnahmen und Gemälde sich materiell manifestieren, ist die Wirkung performativer künstlerischer Praktiken wie Live-Konzerte, DJ-Sets, Happenings zwar flüchtig, aber nicht weniger nachhaltig. Deren Dokumentation ist natürlich in der Regel etwas schwieriger und angewiesen auf mündliche Überlieferung. Die Geschichte der Disco-Bewegung nur anhand von Platten zu erzählen wäre völlig verkehrt, da es ja ganz offensichtlich darum ging, in welcher Umgebung diese Platten gespielt wurden und was sie auslösten. Disco Demolition „Love Saves the Day“ endete mit der Disco Sucks Kampagne und der Disco Demolition Night, bei der im Juli 1979 in Chicago in der Pause eines Baseball-Spiels vom Rock-Radio-DJ Steve Dahl tausende Disco-Platten in die Luft gesprengt wurden. Er hatte seine Anhänger dazu aufgefordert, ihre lästig gewordenen Discoplatten ins Stadion mitzunehmen. Der Rasenschaden durch die Explosion und die das Feld stürmenden Rowdies war beträchtlich. Lawrence erinnerte vor kurzem anlässlich des Sieges von Donald Trump via Facebook an dieses Ereignis und bezeichnete es als frühen Hinweis auf die revoltierende weiße Arbeiterklasse des Rust Belts, die in der von Homophobie und Rassismus getragenen Disco Sucks Kampagne ihren Hass auf das urbane Sodom-und-Gomorrah freien Lauf ließ. Sein aktuelles Buch „Life and Death on the New York Dance Floor, 1980 – 1983“ schließt unmittelbar daran an und beschäftigt sich mit einer Periode, die üblicherweise in der Pop-Geschichtsschreibung als Übergangsphase wahrgenommen wird. Doch auch New York City selbst befand sich Anfang der 1980er-Jahre im Umbruch. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Noch ein paar Jahre vorher war die Stadt vor dem Bankrott gestanden. Die schwierige wirtschaftliche Situation nach der Ölkrise nutzten Spekulanten als Vorwand die Stadt zu erpressen und die zunehmende Abwanderung durch die Verteuerung der innerstädtischen Mieten in die Suburbs hatte zu einem massiven Rückgang der Einnahmen geführt. US-Präsident Gerald Ford verweigerte vorerst sogar die Finanzhilfe (mit der berühmten Schlagzeile „Ford to City: Drop Dead.“), nur um später doch noch einem Milliarden-Dollar-Kredit zustimmen zu müssen, da die Folgen einer völligen Zahlungsunfähigkeit unabsehbar gewesen wären. Die Finanzen der Stadt wurden einer staatlichen Finanzaufsicht (Emergency Financial Control Board) unterstellt, die einen rigiden Sparkurs einleitete und von Bankern und Topmanagern dominiert wurde. Die Zeichen standen fortan unter dem Unstern der Austerität, die unter dem 1977 frisch gewählten Bürgermeister Ed Koch noch verstärkt wurde. Trotz Konsolierung in der Budgetsituation hieß die Zauberformel künftig hart bei den Ausgaben zu sparen und Steuern zu senken, vor allem für Unternehmen. Zu den Profiteuren dieser Politik gehörten die Wall Street und Immobilienhaie wie Donald Trump. Präsident Reagan und seine Administration ließen sich von New York City inspirieren. Disco Mutant Doch bevor Manhattan völlig von den Yuppies übernommen wurde, profitierten die Freaks von niedrigen Lebenskosten und New York City erlebte einen einzigartigen Boom an Clubs in einem musikalischen Setting, dessen große Überschrift Innovation und Vermischung lautete. Überall in der Stadt wurde an neuen musikalischen Entwicklungen gearbeitet, die sich vorerst jeglicher Genre-Zuordnung entzogen und die vor allem unter dem Zeichen der Vermischung und Mutation bekannter Stile standen. Die Opposition sowohl von Punk als auch von früher Rapmusik gegenüber Disco (soweit sie überhaupt vorhanden war) verwandelte sich zusehends in eine gegenseitige Durchdringung. Neue Locations wie der Mudd Club und der Club 57 prägten eine experimentierfreudige Generation junger Menschen, die Partys als Kunstevents mit Theaterperformance, Live-Bands, DJs und Videoprojektionen veranstalteten. Unkonventionelle DJs wie Anita Sarko, die keinen Stilbruch scheute, erweiterten die Vorstellung davon, wie gegensätzlichste Genres miteinander vermischt werden können. Und der noch heute als Halbgott der House-Music verehrte Larry Levan regierte im Paradise Garage, dem Prototyp des modernen Clubs schlechthin. Zwei Kräfte veränderten diese vibrierende Szene jedoch im Laufe der Jahre. Einerseits drang immer mehr Geld nach Manhattan. So wurde der noch immer aktive David Mancuso 1984 gezwungen, aus seinem Loft auszuziehen und fand nie wieder eine derart gut geeignete Bleibe. Viele Clubs wurden geschlossen oder kommerzialisiert. Die Gentrifizierung Manhattans hatte begonnen. Andererseits verbreitete eine völlig unheimliche Krankheit Angst und Schrecken unter den Partygängern. Die Drastik mit der HIV/AIDS diese lebendige Community traf, ist kaum zu fassen. Die verheerende Wirkung auf die Dance-Szene in den USA, die sich daraufhin für lange Zeit völlig in den Untergrund begab, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. So verlagerte sich das Geschehen langsam in die europäischen Clubs, wo Techno um 1990 herum seinen Durchbruch feierte. Für sein nächstes Projekt hat Tim Lawrence übrigens schon die Interviews gemacht. Die Geschichte von Chicago House und Detroit Techno will auch erst einmal in dieser Qualität erzählt werden. Tim Lawrence, Life and Death on the New York Dance Floor, 1980–1983 (Duke University Press) online seit 08.03.2017 14:04:23 (Printausgabe 77) autorIn und feedback : Christian König |
|
Mixtape by gesterngirl gesterngirl alias Rania Moslam ist Veranstalterin (BRUTTO, Viennese Soulfood, SoloTogether), Fotografin und DJ in Wien. [03.10.2018,gesterngirl] Was bringt ein Nachtbürgermeister? Ein persönlich gehaltener Beitrag zur laufenden Debatte [29.09.2018,Christian König] Mixtape by Electric Indigo Electric Indigo pendelt als DJ, Komponistin und Musikerin zwischen Wien und Berlin. [21.05.2018,Electric Indigo] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
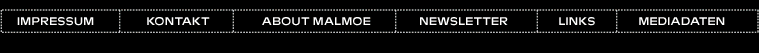 |