
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||

|
Lebenswerte Stadt für Alle Bürger_innen initiativ gegen die Privatisierung des öffentlichen Raumes 2011 wurde bekannt, dass Teile des ehemaligen psychiatrischen Krankenhauses Baumgartner Höhe verbaut werden sollten. Im Sommer wurde mit dem Bau eines „Wellnesszentrums“ begonnen, geplant sind noch weitere 600 Wohnungen – teuer, in luxuriöser Lage. An einer Versammlung am 28. September 2011 beteiligen sich an die 800 Bürger_ innen, auch viele Anrainer_innen, die aus unterschiedlichen Motiven gegen den Bau protestieren: aus Denkmalschutzgründen, weil die weltbekannten Jugendstilbauten von Otto Wagner von höheren Häusern umgeben werden sollen, weil der Autoverkehr zunehmen wird, aber auch gegen die Einschränkung der öffentlichen Zugänglichkeit: Spaziergänger_ innen konnten bisher zwischen den Pavillons auf die Steinhofgründe hinauf flanieren. Die Breite des Widerstandes überrascht Rot wie Grün Zur Vorgeschichte: Um 1980 waren die Steinhofgründe schon einmal Objekt einer Bürger_inneninitiative (BI) (1). Die Verbauung wurde nach einer Volksbefragung aufgegeben, die Fläche am Rand des Wienerwaldes blieb öffentlich zugängliches Erholungsgebiet. Damals noch auf Seite der Bürger_inneninitiative, wird den Grünen, mittlerweile in der Wiener Stadtregierung gelandet, nun vorgeworfen, still zu halten. Die „Kronen Zeitung“ unterstützt die BI im Gegensatz dazu. Schließlich sprach Ende Oktober Bürgermeister Michael Häupl ein Machtwort und schloss nach der Fertigstellung des Wellnesszentrums vorerst eine weitere Verbauung des Naherholungsgebietes aus. Die BI soll durch ein Mediationsverfahren besänftigt werden. Dass der Widerstand gegen dieses Projekt solche Ausmaße annehmen konnte, hat mehrere Gründe. Sie lassen sich aber nicht alleine darauf reduzieren, dass eventuell relativ privilegierte Anrainer_innen in einer guten Wohngegend sich gegen die Baupläne stellen und dabei von der „Kronen Zeitung“ unterstützt werden. Bedeutendes Anliegen dieser Anrainer_ innen ist besonders die Zunahme von Verkehr im Einzugsbereich. Den Argumente der Stadt Wien, dass eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr stattfinden werde, wurde jedoch mit Skepsis begegnet. Die dort neu anzusiedelnden, besser gestellten Leute werden kaum bereit sein, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und besitzen außerdem eher teure und große Autos. Die zahlenmäßige Breite der Mobilisierung von Bürger_innen wurde aber vor allem erreicht, weil das Erholungsgebiet schon einmal gerettet wurde und weil es sich bei den Steinhofgründen um einen nicht-kommerziellen Ausflugsraum handelt, der von zehntausenden Wiener_innen genutzt wird. Es geht also bei diesem Beispiel, wie so oft, gegen die Privatisierung des öffentlichen Raumes und verweist damit auch auf eine allgemein politische Situation im Städtebau, die besonders in Österreich durch ein Klüngelwesen von Politik und Unternehmen geprägt ist: Bauprojekte werden durchgesetzt, weil entsprechende Baufirmen Aufträge bekommen sollen. Verdrängung „auffälliger“ Personen aus dem öffentlichen Raum Der Kapitalismus hat die Tendenz, immer mehr Bereiche seiner Verwertung zu unterwerfen. Was gewünscht und beliebt ist, muss etwas kosten, um daraus Profite zu erwirtschaften. Die oben beschriebene Initiative findet also in eine Zeit statt, die mit zunehmenden Kämpfen in der Stadt um den öffentlichen Raum verbunden ist und (vielleicht) mit der Vielfalt weltweiter Bewegungen in den Städten zusammen fällt. Ein Ausdruck dieses Kampfes um urbanen Raum ist die Verdrängung „auffälliger“ Personen aus kommerziellen aber öffentlichen Sphären. In den Einkaufszentren wie der Wiener „Lugner City“ oder in Bahnhöfen wurde dieses private Verhältnis schon lange durchgesetzt. Securitys schmeißen dort unliebsame Personen einfach hinaus. Auseinandersetzungen konzentrierten sich zeitweise aber auch um die Mariahilfer Straße, zuerst durch die versuchte Verdrängung von Punks, etwa durch absurde Gesetze wie die Strafbarkeit von „unbegründetem Stehenbleiben“. Ein weiterer Ausdruck dafür ist in vielen Teilen der Stadt die Verfrachtung von Obdachlosen und Drogennutzer_innen in die Unsichtbarkeit. Nachdem das gelungen ist, wird die Ausgrenzung mit rassistischen Kampagnen gegen Bettler_innen Schritt für Schritt fortgesetzt. Das trifft gerade Bettler_innen, müssen diese schließlich sichtbar bleiben, um erfolgreich sein zu können. Der Prozess schreitet voran: Mittlerweile gibt es auch wieder vermehrt Diskussionen um „geschäftsstörende“ Kundgebungen und Demonstrationen auf der beliebten Wiener Einkaufsstraße. Widerstand regt sich:„Recht auf Stadt“ Doch auch gegen diese Vertreibungspolitik regt sich Widerstand. Seit Jahren führt die Obdachlosenzeitung „Augustin“ Kampagnen gegen diese Verdrängungen aus dem öffentlichen Raum. So werden seit zehn Jahren an jedem Freitag den 13., Aktionen im öffentlichen Raum durchführt, an denen sich je nach Witterung einige hundert Menschen beteiligen, um gegen die Einschränkungen der städtischen Bewegungsfreiheit zu Gunsten des Kapitalismus zu protestieren. Ganz in diesem Sinn gab es auch eine Demonstration auf dem Christkindlmarkt im Dezember 2011 gegen die fortschreitende Kommerzialisierung von Raum, weil dessen Betreiber_innen Straßenverkäufer_ innen das Anbieten von Zeitungen verboten, um den Weihnachtskonsum nicht zu stören. Eine temporäre Aneignung des öffentlichen Raumes bedeuten auch die unterschiedlichen Formen von Paraden, die mehr oder weniger politisch und / oder kommerziell durchgeführt werden. Die jährliche „Regenbogenparade“ durch die LGBT-Community (lesbisch-schwul-bi-trans) ordnet sich schon in die kommerzialisierte Event-Kultur ein, aber es gibt immerhin Initiativen um Aktivist_ innen, etwa aus der Rosa-Lila-Villa, denen so ein Event-Spektakel zu wenig ist. Andere Paraden sind etwa die FreeParade, die als Alternative zur stärker kommerziellen Love Parade und als Fortsetzung der musikalischen (Techno-)Events gegen die FPÖ-Beteiligung an der Regierung, der Free Republic, einige Jahre lang stattfand. Und nicht zuletzt ist die MayDay-Parade ein Ereignis am Nachmittag des 1. Mai, bei der es auch um die Sichtbarmachung des prekären Lebens und der prekären Arbeit in der Stadt geht. Occupy? Kein neues Phänomen! Auch wenn wegen Neubauten, Umbauten etc. öffentliche Räume, vorerst durch Baustellen, später dann allgemein, eingeschränkt werden, entwickelten sich in den letzten Jahren immer wieder längerfristige Initiativen. Spektakulär war die Besetzung des Augartenspitzes, um den „Konzertkristall“ für die Wiener Sängerknaben zu verhindern. Ein Bauprojekt der mit der Politik verbundenen, wirtschaftlichen Elite in Wien. Dieser hartnäckige Aktivismus (noch immer finden wöchentliche Kundgebungen am Spitz statt) hat zwar eine Niederlage erlitten – der Bau wurde inzwischen begonnen – kann aber trotz alledem als Erfolg verbuchen, dass durch seine Hartnäckigkeit zumindest verhindert wurde, dass jede weitere Verbauung des Augartens zurückgestellt wurde. Um die Produktion von nicht-kommerziellem Raum, wenn auch im Übergangsbereich zwischen privat und öffentlich geht es auch bei einer Reihe von (Haus-)Besetzungen. In den letzten Jahren entwickelte sich in Wien eine neue Kultur des Besetzens. Sie hatte ihren Höhepunkt mit der „Uni-brennt“-Bewegung durch die Besetzung einer Reihe von Hörsälen, aber auch durch zahlreiche Hausbesetzungen vor und nach 2009. So die Besetzung in der Lindengasse im 7. Bezirk im Herbst 2011 als „Epizentrum“. Dort und anderswo wurde versucht, politisches und kulturelles Leben mit Wohnen zu verbinden. Wohnen sollte ein Menschenrecht sein und nicht hauptsächlich eine Quelle von Profit. Das öffentliche Leben kehrt erneut in die Stadt zurück Die Idee der „fordistischen“ Stadt bedeutete bis in die 1960er die Aufteilung der Bereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit, verbunden durch den (Auto-)Verkehr, der Autoinnenraum als privater Bereich für das Individuum (oder die Familie). Durch die Vielfalt der Bewegungen, die sich gegen das Verschwinden des öffentlichen Raumes, die genutzten Plätze und Straßenecken wehrten, vom Kampf für Jugend-, Kultur-, Kommunikations- und Soziale Zentren bis hin zur individuellen Verlagerung des Lebens wieder auf die Straßen änderte sich die Stadtstruktur wieder. Das öffentliche Leben kehrt erneut in die Stadt zurück und beschränkt sich nicht mehr nur auf touristische und Freizeitzentren. Arbeit, Wohnen / Leben und Freizeit finden wieder in denselben Stadtvierteln statt. Das wirkt sich bis hin zur Stadtplanung von Wien aus, die in der geplanten neuen Wohnsiedlung „Seestadt Aspern“ zuerst Alternativprojekte ansiedeln will, damit keine unbelebten Wohnghettos wie die sprichwörtliche „Großfeldsiedlung“ entstehen. Befördert wird das auch durch die Zunahme des Dienstleistungssektors, umgekehrt bewirkt die Veränderung der Freizeitstruktur eine Zunahme der Dienstleistungen. Auch die Arbeit ist wieder in die Stadtviertel zurückgekehrt. Verbunden ist das mit den oben erwähnten Auseinandersetzungen, weil sowohl die Bevölkerung als auch das Kapital diese attraktiven Bereiche nützen will. Ausblick Was hat das alles mit der erstaunlich breiten Bewegung gegen die Verbauung der Steinhofgründe zu tun? Es geht hier um einen (noch) nicht kommerziell genutzten Freizeitraum. Gerade darum ist diese Auseinandersetzung auch eine soziale Frage. Aus den bestehenden Resten der Struktur des „Roten Wien“ gibt es bis heute Möglichkeiten für die Allgemeinheit, die in anderen Städten schon auf eine privilegierte Klientel beschränkt wurden. Doch dieser Trend macht auch vor Wien nicht Halt. So beispielsweise an der Alten Donau, wo die Schrebergärtner_innen vertrieben werden und große Häuser mit Blick auf das Wasser für eine betuchte Klientel gebaut werden. Selbst die mit der Gemeinde verbundenen Baufirmen haben – wie sollte es auch anders sein – nur den Profit im Sinn. So sollen die Hänge des Wiener Waldes nicht mehr für die da sein, die dafür nie zahlen könnten, sondern für die, an denen Immobilienfirmen verdienen können – und das gefördert durch die (Sozialdemokratie der) Gemeinde Wien. Sichtbar gemacht wurde dieser Verdrängungsprozess aus den guten Wohngegenden diesen Sommer auch durch die Besetzung des Lobmeyrhofes im 16. Bezirk, wo die Wohnungen durch das gemeindeeigene „Wiener Wohnen“ aufgewertet werden sollen. Auch der sozialdemokratische Klüngel spekuliert auf steigende Immobilienpreise, obwohl sich doch gerade der Wiener Büromarkt bereits als Blase erwiesen hat. Von den ab den 1990ern gebauten Hochhäusern stehen heute viele leer. Das Ausgeben von Geld, um teuren Wohnraum zu schaffen und um die mit der Politik verbundenen Baufirmen zu bedienen, in einer Zeit, wo vom Sparen geredet wird, könnte zu einer Bewegung führen, die die kapitalistischen Vorgaben der Gemeinde Wien infrage stellt. Beim Umbau des Westbahnhofes und beim Bau des Hauptbahnhofes wurde maßgeblicher Widerstand versäumt, obwohl diese Projekte genau so problematisch sind wie „Stuttgart 21“. Das Gleiche gilt für den Umbau der Gasometer oder den Bau der Donauplatte schon viele Jahre zuvor. Wie bei den meisten Bauprojekten geht es beim Widerstand dagegen um die städtebauliche und kapitalistische Normalität und für die Erhaltung eines öffentlichen Lebensraumes für alle, nicht nur für diejenigen, die privilegierte Wohnumgebungen bezahlen können. 1) Der folgende Absatz hauptsächlich nach www.aktion21.at/themen/index.html?menu=183 online seit 26.04.2012 14:48:39 (Printausgabe 58) autorIn und feedback : Robert Foltin Links zum Artikel:
|
|
Alle irgendwo angrennt Poesiealbum Schwarz-Blau #4 Neue Einträge ins österreichische Stammbuch im irritierend warmen September 2018. [29.09.2018,Brr, FJ] Armenier*innen lehnen Sersch ab Die „samtene Revolution“ in Armenien [28.09.2018,Thomas Rabensteiner] Vom Roten Wien zum Rebellischen Wien Wiens besondere Voraussetzungen machen die Stadt zu einem Möglichkeitsraum [23.06.2018,Rainer Hackauf] die vorigen 3 Einträge ... die nächsten 3 Einträge ... |
|||
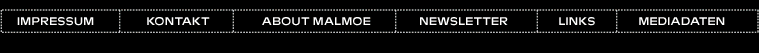 |