
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||

|
Biete Raum! Suche Idee! Gedankenskizze zum Umgang mit Leerstand in Wien Das Wiener rot-grüne Regierungsübereinkommen vom November 2010 sieht die Errichtung einer Zwischennutzungsagentur für leerstehende Gebäude, Brachflächen und Baulücken vor. Die Agentur soll als Koordinationsstelle Informationen über leerstehende private und öffentliche Räume zusammentragen und auf Anfrage weitergeben. In einem fachöffentlichen und stadtpolitischen Diskurs zeigt sich, dass an diese Absichtserklärung der Stadt unterschiedliche Erwartungen geknüpft werden. Bisher wurden aber nur wenige interessensübergreifende Schritte gesetzt, die zu einer genaueren Spezifizierung dieser Agentur beitragen könnten. Die Praxis zeigt, dass in Wien Erfahrungswerte und Strategien im Umgang mit Leerstand vorhanden sind, deren systematische Aufarbeitung unseres Erachtens kritisch in die Diskussion einzuflechten ist. Der Zeitpunkt erscheint richtig, um ein vertiefendes Nachdenken über Leerstand anzuregen, die vorhandenen Ressourcen, Potenziale und Risiken von leerstehenden Räumen im Sinne von „Freiräumen“ aufzudecken, sowie die Frage zu stellen, wie mit diesem „Leerstandswert“ in einem planerischen Verständnis umgegangen werden soll. In diesem Sinne liefern wir hier eine Gedankenskizze zum perspektivischen Umgang mit Leerstand. Strategien der Leerstandsnutzung in Wien Entlang der historischen Entwicklung von Aneignungen und Umgang mit Leerstand in Wien ist eine Kursänderung in den stadtpolitischen Strategien ablesbar. Die historisch älteste Aneignungsform ist die Besetzung, ein Zugang, bei dem die Stadt als politische Akteurin zunächst nicht aktiv handelt, sondern erst reagiert. Dabei pendelt das Verhalten der Stadtpolitik seit den 1970er Jahren zwischen Anpassung und Räumung, wodurch es entweder zur Verhinderung von Besetzungen oder zu deren Institutionalisierung kam (wie etwa im Fall der Arena, des Amerlinghauses oder des WUKs). Eine weitere Strategie im Umgang mit Leerstand sind große kulturelle Zwischennutzungen seit den 1990er Jahren, wie etwa das Kabelwerk. Als neues stadtplanerisches Ziel wird hier die Idee des Brandings deutlich, also das Bekanntmachen eines Ortes noch vor der geplanten dauerhaften Nutzung. Noch deutlicher tritt diese Dimension bei der jüngsten Strategie in den Vordergrund, den in den 2000er Jahren modern gewordenen Belebungsstrategien für leere Geschäftslokale in den Erdgeschoßzonen. Initiativen wie Aktive Gumpendorferstraße oder Lebendige Geschäftsstraßen bieten sozio-kulturellen Projekten oder start-up Unternehmen kurzfristig reduzierte Mieten in ausgewählten Straßen, um eine Reaktivierung sterbender Einkaufsstraßen zu bewirken sowie lokale Ökonomien zu stärken. Vor allem an die letzten beiden Strategien knüpfen sich Fragen an: Wer entscheidet über den Zugang und die Nutzung? Welche sozialen Gruppen respektive sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen Initiativen sollen unterstützt werden? Welche (un-)beabsichtigten Folgen hat das für ein Stadtquartier? Leerstand = „Freiraum“ Welche Räume rücken ins Zentrum des Interesses, wenn die Stadt Wien über die Errichtung einer Zwischennutzungsagentur nachdenkt? Obwohl auch der Leerstand von Wohnraum Schätzungen zufolge von großer Relevanz in Wien ist 1, handelt es sich bei der durch die Stadtregierung anvisierten Agentur um eine Stelle für die Vermittlung sozio-kultureller Projekte in nicht genutzten Industriebauten und Geschäftsinfrastrukturen, deren Leerstand auf (teilweise) spekulatives ,Nicht- Handeln‘ bzw. ökonomisches ,Nicht-Handeln- Können‘ zurückzuführen ist. Hinter der Aufforderung zur Nutzung dieses Leerstands steht zunächst der simple Gedanke, dass es eine Gleichzeitigkeit von leerstehenden Räumen und einem ungedeckten Bedarf bestimmter sozialer Gruppen gibt. Diesen sozialen Gruppen sind Räume am normalen Mietmarkt nicht zugänglich und sie sind daher auf spezielle Arrangements mit reduzierten Mieten angewiesen. Es kann sich um soziale Initiativen handeln, um kulturelle und künstlerische Projekte oder um gewerbliche Unternehmen, die (noch) nicht genügend ökonomische Kapazitäten haben. Ein im Wiener Kontext unüblicher Gedanke, den wir hierzu aufwerfen möchten ist, diesen Initiativen oder Projekten ohne konkrete Erwartungshaltung an den Output der Nutzungen Räume zu öffnen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Freiräumen, die Selbstverwaltung und Experimente möglich machen und auf lange Sicht soziokulturellen Mehrwert und Innovationen generieren können. Leerstand und Hoffnung Neben dem positiven Effekt, den die Öffnung von leerstehenden Räumen für die Nutzer_innen selbst zur Umsetzung ihrer Ideen haben kann, können solche Projekte auch Einfluss auf ihre Nachbarschaft haben. Wie schon in den oben beschriebenen Belebungsstrategien für Geschäftsstraßen angedeutet, hat sich in den letzten Jahren die Hoffnung in vielen Stadtentwicklungskonzepten eingeschlichen, dass sozio-kulturelle und künstlerische Projekte zur Aufwertung eines Quartiers führen. Diese Erwartung ist unseres Erachtens jedoch sehr ambivalent. Von der Ansiedlung dieser Projekte wird angenommen, dass sie Aufmerksamkeit auf eine – bis dato vernachlässigte und sozio-ökonomisch benachteiligte – Nachbarschaft lenken, die Atmosphäre von Innovation verbreiten und Investition von Kapital in die Infrastruktur der Stadtteile bewirken – capital flows where attentions goes. Hieran können sich einerseits Verdrängungsprozesse koppeln, wenn Mieten steigen und sozio-ökonomisch schwächere Haushalte den Stadtteil verlassen müssen. Andererseits können Leerstandsnutzungen aber auch Belebungsimpulse für die Nachbarschaft gegen eine Atmosphäre der Stagnation haben und als Begegnungsorte im Quartier dienen. Für das stadtpolitische Handeln ergibt sich ein Balanceakt zwischen dem Zulassen von Freiräumen und Selbstverwaltung und der Sicherung leistbaren Wohnraums sowie dem Ausgleichen sozio-ökonomischer Diskrepanzen. „Leerstandswert“ aktivieren! Die Anforderungen an eine Zwischennutzungsagentur oder allgemeiner ein Leerstandsmanagement besteht im Ausgleich ambivalenter Herausforderungen und Perspektiven. Die von uns postulierte Forderung „Freiräume zulassen“ wirft Fragen nach den Grenzen der Planbarkeit auf. Ein Leerstandsmanagement erfordert daher vor allem behutsame und kreative Strategien, ein Um– und Querdenken, welche nicht den Diskurs um creative cities aufgreifen, sondern vielmehr eine Abkehr eingetretener Pfade und Denkweisen hin zu einem neuen Verständnis im Umgang mit leerstehendem Raum erfordern. Eine integrierte und kooperative Planungsauffassung legt dabei den Fokus auf soziale Gruppen, Stadtteilakteur_ innen sowie Klein- und Kleinstunternehmer_ innen als potenzielle Leerstandsnutzer_innen, die nicht mit dem Stempel be creative! versehen werden. Solidarische, kreative, innovative und identitätsstiftende Potenziale und Talente von Leerstandsnutzer_innen sollen zwar gefördert, aber nicht als „Aufwertungsmotoren“ instrumentalisiert werden. Um einen Zugang zu leerstehenden Räumen zu erleichtern, braucht es kooperative, koordinierende und dialogbasierte Methoden städtischer Steuerung. Die Partizipationspraxis im Rahmen von Planungsprozessen zeigt deutlich, dass ein breiter Beteiligungsprozess auf allen Stufen von Beteiligung unter Einbeziehung eines breiten Akteurssettings eine besondere Bedeutung hat. Gerade im Umgang mit Leerstand müssen stark divergierende Interessenskonflikte ausgehandelt, manchmal aber auch ausgehalten werden. So können ökonomische (Raum)Verwertungsinteressen von Eigentümer_innen den Bedürfnissen der Nutzer_innen ohne starke Finanzdecke sowie dem städtischen Gemeinwohlinteresse gegenüber stehen. Ein aus unserer Sicht wichtiger Schritt liegt in der Überwindung des Ressortdenkens, denn erst wenn Kultur, (soziale) Stadtplanung und Wirtschaftsförderung zusammengedacht werden, können die Ressourcen adäquat entwickelt werden. Die Etablierung einer Zwischennutzungsagentur wird im Regierungsübereinkommen unter der Überschrift „Kunst und Kultur“ besprochen, die Überschneidungen zu sozialen und ökonomischen Themen scheinen bei genauerer Betrachtung jedoch mehr als deutlich. Um einen inkludierenden Blick auf die Stadtteilentwicklung wahren zu können, müssen im Rahmen einer Zwischennutzungsagentur sowohl gesamtstädtische als auch stadtteilbezogene Strategien transparent erarbeitet, kommuniziert und umgesetzt werden. Wichtig erscheint die Sicherstellung der Zugangserleichterung zu leeren Räumen, Strategien der Mehrfach- und Zwischennutzungen sowie flexible Nutzungsrechte, das Möglichmachen von Selbstorganisation bei gleichberechtigter Ressourcenausstattung und das Erleichtern der Kommunikation zwischen den Akteur_innen, damit Räume des Experimentierens und Ausprobierens entstehen können. Wencke Hertzsch und Mara Verlic sind Universitätsassistentinnen am Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung der TU Wien und arbeiten als wissenschaftliche Leiterinnen im Rahmen der Studie „Perspektive Leerstand“ (im Auftrag der IGKultur, gefördert durch die MA7). Ein Dank geht an Gesa Witthöft, Sebastian Raho und Justin Kadi für die konstruktive Diskussion entlang des Textes. 1) Genaue Zahlen dazu liegen nicht vor. Schätzungen gehen aber von 60.000 bis 80.000 leerstehenden Wohnungen in Wien aus. online seit 27.03.2012 13:24:04 (Printausgabe 58) autorIn und feedback : Wencke Hertzsch und Mara Verlic Links zum Artikel:
|
|
Für einen queerfeministischen Antifaschismus Fragen von Geschlechterverhältnissen und Sexualität sind zentral für Autoritarismus und Faschisierung, doch noch immer Randthemen im antifaschistischen Aktivismus. [02.10.2018,Einige Antifaschist*innen] Regierungsspitzen London - Athen - Salzburg (MALMOE #84) [01.10.2018,Redaktion] Özil, Merkel, Erdoğan, Zirngast und Kneissl Das Verhältnis Europas zur Türkei ist schlecht. Ein Überblick über die Beziehungskrisen eines heißen Sommers. [30.09.2018,Frank Jödicke] die vorigen 3 Einträge ... die nächsten 3 Einträge ... |
|||
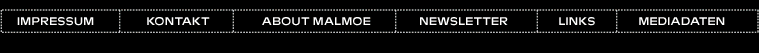 |