
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
Endlose Ströme Streaming wird den Musikmarkt noch stärker verändern als bisher angenommen. Im Verband der österreichischen Musikwirtschaft (IFPI Austria) herrscht zurzeit Jubelstimmung. Ende Jänner gab die hiesige Sektion des Weltverbands der Phonoindustrie in einer Presseaussendung bekannt, dass die schon am Boden geglaubte Musikindustrie wieder Morgenluft wittern kann. Es geht bergauf. Der Musikmarkt im Tonträgerbereich ist wieder ein Wachstumsmarkt. Der komplette Musikbericht für 2017 liegt zwar noch nicht vor, aber tatsächlich lässt sich ein Trend feststellen. Zumindest für den Moment. Und auch nur wenn die Sache global betrachtet wird. Der weltweite Musikmarkt hatte schon 2015 die Trendwende geschafft, die nun auch Österreich mit einiger Verzögerung erreicht: 2017 erwirtschaftete der Tonträgermarkt laut IFPI Austria mit € 145,5 Mio ein Plus von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Value Gap Der Begriff Tonträger ist allerdings etwas unpräzise geworden. Denn hauptverantwortlich für dieses Umsatzplus ist nicht etwa der mittlerweile völlig gehypte Vinyl-Sektor. Der Marktanteil von Vinyl-Schallplatten liegt trotz ordentlicher Zuwachsraten bei nur 5,4 % und ingesamt schrumpft der Verkauf von physischen Tonträgern sogar. CDs und DVDs sind quasi auf dem Weg zum Nischenprodukt. Auch das Geschäft mit den Downloads lief schon mal besser. Tatsächlich ist das Wachstum auf jenen Sektor zurückzuführen, auf den der Begriff Tonträger kaum mehr anzuwenden ist, weil er Tonaufnahmen gar nicht mehr handelt und verkauft, sondern nur temporär zum Abspielen zur Verfügung stellt: die Rede ist vom Streaming. Vor allem Abo-Dienste wie Spotify, Apple Music, Deezer und Amazon unlimited tragen zu diesem Wachstum bei. Denn obwohl die meisten Menschen Musik über YouTube (=Google) hören, ist die Wertschöpfung pro User eine um das zwanzigfach geringere als bei Spotify & Co. Die Diskussion um diesen sogenannten „Value Gap“ wird von der Industrie in den letzten Jahren angeheizt und trägt mitunter schrille Züge, tatsächlich ist diese Diskrepanz nicht wegzudiskutieren. Es ist kompliziert Bei genauerer Beschäftigung mit den Geldflüssen wird’s allerdings gleich mal kompliziert. Tatsächlich ist der Bereich Streaming noch um einiges intransparenter als andere Bereiche der Musikbranche, mit ihren individuellen Sonderverträgen und anderen neoliberalen Eigenheiten der egomanischen Kreativwirtschaft. Grundsätzlich fließen zwei verschiedene Formen von Geldern an die Artists: Tantiemen von Verwertungsgesellschaften und Anteile an den Erlösen der Streamingdienste. Obwohl das Gerücht kursiert, dass sowohl YouTube als auch Spotify (u. ä. Streamingdienste) nichts an die AKM und austro mechana (AUME) zahlen, liegen Verträge zwischen den Parteien vor, die eine Rechte-Entgeltung regeln. Es fließen hier also Tantiemen ähnlich wie bei einer Ausstrahlung im Radio oder Fernsehen. Das einzige Problem: Der genaue Inhalt und die detaillierte tarifliche Einigung zwischen Verwertungsgesellschaften und den jeweiligen Streaming-Unternehmen ist nicht öffentlich bekannt. Dies ist zwar ob der Monopolstellung der AKM/Austro Mechana etwas seltsam, aber rechtens. Der Inhalt von diesen sogenannten Sondervereinbarungen muss nicht veröffentlicht werden. Zur Beliebtheit von Streamingdiensten unter Musiker_innen, wenn diese auf ihre AKM Abrechnung sehen, trägt dies aber mit Sicherheit nicht bei. Bei den Erlösanteilen ist die Sachlage ähnlich, denn auch hier ist die Berechnung für einzelne Artists meist völlig intransparent. Dies hat jedoch andere Ursachen. Wie in der Welt der physischen Tonträger sind auch bei der Verwertungskette von Musikaufnahmen im Bereich Streaming eine Reihe von Akteuren beteiligt, die alle – je nach individuellen Verträgen – am Umsatz beteiligt sind: Label, Vertrieb und der Shop stehen zwischen Artists und Endkunden. Die oft sehr plakativ vorgetragene Klage über die geringen Beträge, die über Spotify & Co ausgezahlt werden, hat oft den Hintergrund von unvorteilhaften Verträgen in der Verwertungskette. Herstellungskosten sind ja quasi bei digitalen Files keine mehr vorhanden, aber vor allem große Majorlabels behalten sich im Streamingbereich denselben großen Anteil vom Kuchen, wie schon beim CD Verkauf. Ein Punkt wird jedoch viel zu wenig kritisiert, obwohl viel heikler: die Datentransparenz. Der Großteil des Einkommens der Streamingdienste wird über Abos erwirtschaftet. Die Artists bekommen einen Anteil dieser Gelder ausgezahlt. Je öfter eine Musiknummer gespielt wird, desto höher ist der Anteil am Gesamtkuchen der Einnahmen. Einen Einblick in die Berechungsgrundlagen von Spotify & Co zu erhalten ist jedoch nicht möglich. D. h. Musikproduzent_innen und deren Partner_innen sind völlig angewiesen auf die Angaben des Streamingdienstes, eine Kontrolle ist nicht möglich. Gerade für Fans ist das auch bitter. Denn es fließt nicht automatisch Geld vom Fan zum Artist, sondern der Fan erhöht mit dem Play nur den Anteil des Artists am ominösen Gesamtkuchen. Auf Dauer ist das natürlich ein unhaltbarer Zustand, der uns noch lange beschäftigen wird. Über Big Data werden schließlich heutzutage Monopole einzementiert. Spotify als globaler Monopolist Marktführer Spotify wird von Jahr zu Jahr mächtiger und bestimmt jetzt schon das Musikbusiness auf eine Art und Weise wie kaum ein anderer Konzern jemals zuvor. So werden die Veröffentlichungszyklen von Singles direkt auf die Bedürfnisse von Spotify abgestellt. Der Streamingdienst hat das Radio längst als wichtigstes Promotiontool abgelöst. Auf der Plattform selbst bestimmen Playlists das Geschehen. Die hauseigenen Playlists sind dabei die wichtigsten. Diese Playlists haben eine enorme Marktmacht entwickelt und werden auch schon mal als die neuen Gatekeeper angesehen. Wer dort gespielt wird, kann oft gleich mal auf einen Zuwachs von einer Million Plays in kurzer Zeit bauen. Die Kurator_innen dieser Playlists sind meist nur absoluten Insider_innen bekannt und nicht greifbar für klassische Promotion wie noch beim Radio, da sie richtiggehend abgeschirmt werden. Die Benutzungsoberfläche von Spotify ist völlig darauf ausgelegt, die Kontrolle an die Playlists auszulagern. Individuelle Ordnungssysteme können selbst nur über die Anlage eigener Playlists organisiert werden. Das Prinzip des Artist-Folgens wird ab Nummer 10 der Liste völlig unübersichtlich. Musiknerds, die es gewohnt sind hunderte Namen im Auge zu behalten, werden nicht wirklich glücklich sein mit den Möglichkeiten, die Spotify zur Verfügung stellt. Labels fallen als Akteure, die von der hauseigenen Spotify-Suchfunktion erfasst werden übrigens völlig weg und somit auch die Produktionszusammenhänge gerade jüngerer oder sich stärker im Untergrund befindlicher Szenen. Streaming ist eine ungeheuer bequeme Möglichkeit, Unmengen von Musik zu konsumieren. Doch es ist wichtig den Preis dieser Bequemlichkeit immer wieder sichtbar zu machen: mehr Kontrolle durch Big Data. online seit 02.05.2018 17:12:55 (Printausgabe 82) autorIn und feedback : Christian König |
|
Passagencollagen #2 Aus der Fassung gebracht [05.10.2018,Tortuga-Kollektiv] DIY-Punk gegen die Spaltung Die Debüt-LP von Lime Crush bringt musikalisch und personell einiges zusammen [03.10.2018,Bianca Kämpf] Eine Stimme für die Stimmlosen Sollte es in einer postpolitischen Phase so etwas wie politische Musik geben, dann war Grime seiner Sache um einige Jahre voraus [03.10.2018,Christoph Benkeser] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
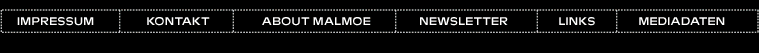 |