
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
Kritikon #4: Elena Messner Textauszug "In die Transitzone" Die vierteilige Serie kritikon setzt in MALMOE 74 bis 77 ausgewählte Positionen österreichischer Gegenwartsliteratur in Dialog mit politischen Fragestellungen und Herausforderungen. Unterstützt von der Edition Atelier präsentieren Elena Messner, Eva Schörkhuber (kritikon #3), Sophie Reyer (#2) und Thomas Ballhausen (#1) poetologische Statements und Textauszüge, die ihre spezifischen Zugriffe auf die alltäglichen Zumutungen unserer Gegenwart deutlich werden lassen. kritikon versteht sich als Einladung zu Auseinandersetzung, Diskurs und vor allem auch: Lektüre. Kuratorische Betreuung: Katharina Menschick, Jannik Eder & Thomas Ballhausen kritikon #4: Elena Messner Der Einfluss von Politik und Ökonomie auf Literatur? Groß. Und umgekehrt der Einfluss von Literatur auf das Rechtssystem und die Wirtschaft eines Staates? Nicht so groß. Woher trotzdem meine Überzeugung, die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst sei nicht nur vorhanden, sondern Literatur nach wie vor ein relevantes Medium für politische Bewusstseinsbildung? Selbst wenn sich AutorInnen nicht als besonders engagiert verstehen, ist Literatur gar nicht außerhalb des „Politischen“ denkbar. Der Literaturbetrieb ist nicht nur ein Markt, sondern darüber hinaus ist das literarische Feld eines, in dem Bildung, Kultur, Recht, Ökonomie und Gesellschaftsleben ineinandergreifen. Die vielbeschworene Depolitisierung einer jungen Generation hat in den letzten Jahrzehnten auch in der deutschsprachigen Literatur Spuren hinterlassen. Warum ist es im heutigen Literaturbetrieb nicht gerade „modisch“, sogar ein wenig verpönt, mit literarischen Mitteln auch politische Fragen zu stellen? Es kann natürlich keineswegs darum gehen, Menschen vorschreiben zu wollen, worüber sie schreiben sollen, aber: Woran liegt es, dass so viele AutorInnen so wenig über die Funktionsweise unserer Gesellschaft schreiben und bestenfalls Symptome, nicht jedoch Ursachen von Krisen und Konflikten zu beschreiben versuchen? Andererseits: Stimmt das überhaupt? Von wie vielen Texten erfährt man bloß schwerer, weil sie in Alternativmedien und Kleinverlagen publiziert werden? Im Band zu einer Tagung, die 2015 im Brecht-Haus in Berlin stattfand, sind die Diskussionsbeiträge der TeilnehmerInnen abgedruckt, die sich mit solchen Fragen beschäftigen – Richtige Literatur im Falschen? lautet der Titel des von Ingar Solty und Enno Stahl im Verbrecher Verlag herausgegebenen Buches. Die weithin bekannte Florian-Kessler-Debatte wird darin erwähnt; der Autor hatte in einem ZEIT-Artikel die bürgerliche Herkunft vieler jüngerer AutorInnen dafür verantwortlich gemacht, dass wir mit einer oft so unpolitischen Gegenwartsliteratur konfrontiert sind. Eine verwandte Debatte, von Jörg Sundermeier angestoßen, wird ebenfalls zitiert: Der Verleger verschob die Ursache für die Depolitisierung der Literatur auf das literarische Feld selbst, insbesondere auf die Literaturkritik. Ähnlich bezichtigte Peter Truschner im Standard-Album eine junge „Generation der Zufriedenen“ – aus bürgerlichen Haushalten stammenden LiteraturstudentInnen und KunststudentInnen – des „Konformismus“, der „institutionellen Bürokratie“ und des „bürgerlichen Hedonismus“. Auch er machte den eventorientierten Literaturbetrieb mit dafür verantwortlich. Ist also der neoliberale Markt an allem schuld? Es irritiert nicht nur, dass solche Debatten in den letzten Jahren rasch wieder erstickt wurden, sondern auch, dass sie fast ausschließlich von Männern ausgetragen wurden; von 18 Teilnehmenden der oben erwähnten Tagung im Brecht-Haus waren z.B. nur vier Frauen. Warum bleibt es ein so oft bestätigtes Klischee, dass Männer häufiger über Politik schreiben? Mir fiel dies in aller Deutlichkeit auf, als ich mich in meiner Dissertation für Prosa schreibende SchriftstellerInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien interessierte – der Frauenanteil war sehr niedrig, unter anderem weil Frauen häufiger Lyrik verfassten als etwa Romane, vor allem aber weil sie auf autobiografische Alltagserzählungen fokussierten. Warum aber? Für Ex-Jugoslawien wäre eine starke Repatriarchalisierung der Gesellschaft nach den Kriegen der 1990er Jahre eine glaubwürdige Erklärung. Im deutschsprachigen Raum ist jedoch der Anteil schreibender Frauen in den letzten Jahrzehnten enorm angestiegen. Interessieren sich schreibende Frauen kaum für Themen wie Ökonomie, Recht und Politik? Ein Eindruck, der sich verstärken könnte, wenn man Helmut Gollners im Mai 2016 in Literatur und Kritik erschienen Artikel Die österreichische Literatur ist weiblich, liest, in dem er 15 junge Autorinnen und deren aktuellste Werke erfasst. Wenn das so ist, stellt sich die Frage nach den Ursachen. Vielleicht gibt es in Österreich trotz herausragender Ausnahmen – Bachmann, Jelinek, Streeruwitz, Frischmuth, Röggla – in der Literatur immer noch zu wenig Vorbilder international bekannter politischer Autorinnen? Oder ist die Angst vor dem Scheitern anhand komplexer Themen zu groß, sodass man sich auf intime, persönliche Geschichten beschränkt, die im Übrigen ebenso politisch erzählt werden könnten wie Kriegs- oder Wirtschaftskrisendarstellungen? Woher die zweifellos nicht nur unter Frauen verbreitete Angst, als „tendenziös“ wahrgenommen zu werden, wenn man beim Schreiben das vorweist, was man „Haltung“ oder gar „Engagement“ nennen könnte? Werden Frauen, und vielleicht auch Männer, die zu politischen Themen schreiben, wirklich weniger besprochen und verkaufen sich schlechter? Seit wann hat sich außerdem die ziemlich dumme Meinung konservativer LiteraturkritikerInnen durchgesetzt, engagierte Literatur sei zumeist ästhetisch anspruchslos? In Anbetracht dieser Lage ist es bemerkenswert, dass sich z.B. eine letztes Jahr in Leipzig neu gegründete Zeitschrift PS – Politisch Schreiben nennt, dass dafür dezidiert politische Essays und Genretexte angefragt werden und dass solch ein Projekt noch dazu von drei Frauen* initiiert wurde. Müssen also Akteurinnen immer noch selbst zu „Institutionen“ werden und sich kollektiv organisieren, wenn die bestehenden Institutionen sie übergehen? Davon abgesehen: Was ist nun mit dem erwähnten Problem, dass Literatur ein „(bildungs-)bürgerliches“ Phänomen bleibt? Immer noch schreiben und lesen Literatur zumeist Zugehörige des Mittelstandes, und so bleiben viele Texte jenen Inhalten treu, die für dieses primäre Zielpublikum interessant sind. Alt, aber nicht passé ist deshalb die Frage, welche Themen und welche Sprache gewählt werden könnten, um eine universale, eine schicht- und bildungsunabhängige Literatur zu verfassen, die aber zugleich die Komplexität eines Themas nicht reduziert und ihr Lesepublikum nicht unterschätzt. Gerade diese Frage beschäftigt mich beim Schreiben weiterhin intensiv, denn sie mündet, obwohl sie zunächst eine poetologische und formal-ästhetische ist, in der wiederkehrenden Grundfrage nach dem sozialen Sinn von Literatur, für mich als Autorin also in der Frage: „Warum und für wen überhaupt schreiben?“ Es gehen mir anstelle von Antworten nur weitere – zwar nicht neue, aber sicherlich auch nicht veraltete – Überlegungen zur politischen Funktion von literarischen Texten durch den Kopf, und dazu die Frage, mit welchem sprachlichen und formalen Handwerkszeug, d.h. mit welchen literarischen Ausdrucksmitteln man komplexe politische und gesellschaftliche Zusammenhänge erzählen kann. In die Transitzone (Auszug) Vor ihm lag der Stadtstrand, von dem Nat ihm erzählt hatte. Der Weg stimmte zumindest, der Stadtkern konnte also nicht mehr weit sein. Er sprang über das Gerüst und landete im weichen Sand, der bei jedem Schritt nachgab, was ihn beim Gehen ziemlich anstrengte. Das Meer sah aus der Nähe ruhig aus, es hatte keinen richtigen Schwung, wirkte aber angenehm frisch. Sich hineinwerfen, um den Schmutz von seinem Körper zu waschen? Er konnte sich nicht dazu überwinden, obwohl der Morgenwind warm war, und vergrub die Hände in den Taschen seines Kapuzenpullovers. Der Wind trieb weiße und blaue Plastiksäcke über den Sand, ließ die Türen zu den Umkleidekabinen hin- und herschwenken, bunte Blasen ploppten vor Daniels Augen auf, Kinder im Sand und ihre Eltern, die barfuß umherliefen, Plastikspielzeug und farbige Badehandtücher, aber das verging schnell wieder. Neben dem Sandstrand ragten Felsen aus dem Meeresboden und darauf war eine Betonformation gesetzt, die an einen Pilz erinnerte, Metalldrähte und aufgerissenes Plastik ragten aus der Platte hervor. Auf der anderen Seite erkannte er die Ruine eines Gebäudes, das zu einem Schwimmklub gehört haben musste, halb abgerissen, mitten in den Renovierungsarbeiten hatte man gestoppt. In Beton eingelassene Glasfronten, auf mehreren Terrassen umgestoßene Liegestühle, die Pools waren lange nicht mehr frisch aufgefüllt oder gereinigt worden, es sammelte sich schimmliger Belag auf den Böden, und in einigen stand dreckiges Regenwasser, das nicht abgeronnen war. Im Grunde ein schöner Strand. Und doch gab es wahrscheinlich nicht viele Orte, an denen man sich fremder fühlen konnte. Ob es an mir liegt? Die allgemeine Verlassenheit erinnerte ihn an die Zollstation und den Kontrollposten, wo er gestern auf dem Weg in die vom Binnenland abgetrennte Stadt aufgehalten worden war. Die letzte Grenze, die er hatte passieren müssen, war kaum gesichert gewesen und große Teile des Drahtzaunes waren zerschnitten, man merkte rasch, dass die Grenzanlage aus noch andauernden Konflikten hervorgegangen war, dass sie provisorisch hochgezogen und dann vernachlässigt worden war. Obwohl sie sicher noch nicht von irgendwelchen Kartographen fertig berechnet und endgültig festgelegt worden war, standen da zwei Kontrolleure in Uniform neben einer rot-weiß gestreiften Schranke vor der Hinweistafel: „You are entering a border area!“, wobei jemand den Spruch: „You are leaving our free international area to defend!“ darübergesprüht hatte. Man hatte ihm abgeraten, sich vom Norden her zu nähern und am Atomzentrum vorbeizugehen, wegen der Polizei, der Feuerwehr und dem Militär. Vom Süden her sei es leichter, da wurden die Stadtgrenzen weniger streng bewacht. Beide waren aber nichts im Vergleich zu den Grenzen zum Mittelmeer hin, die schon durch ihre Erscheinung deutlich machten, dass es ihre Funktion war, die Küstenabschnitte, die man für „sensibel“ hielt, komplett abzuriegeln. Das Meerwasser und der moosige Belag in den Pools riefen ihm mehr und mehr Bilder der letzten Tage ins Gedächtnis. Viele Male war er von Polizisten aufgehalten worden, die sein Gepäck kontrollierten, noch bevor er auch nur in die Nähe der Stadt gekommen war. Niemand hatte aber ernsthaft versucht, ihn von der Einreise abzuhalten, wahrscheinlich, weil er aus dem Landesinneren kam, nicht vom Meer her, und obendrein einen gültigen europäischen Pass hatte. Ein dicker Kontrolleur, der einen gutmütigen Witz machen wollte, hatte zwinkernd auf seinen großen Rucksack gedeutet: „Ihre Geldbörse, nehme ich an?“, und danach beinahe mitleidig geseufzt: „Sind Sie sicher, dass Sie nach Makrique weiterreisen wollen?“ Im Sand steckte eine Spielzeugschaufel, daneben eine kleine Plastikgießkanne. Mit den Füßen schob er sie leicht an, spürte den Sand in seinen Schuhen, die brennende Blase, die aufgeplatzt war und in die das zermahlene Gestein eindrang. Die Umgebung wirkte durch das sich ausbreitende Licht wie ausgebleicht und beruhigte ihn, denn es passte nicht zu den Eindrücken der letzten Monate, dem ganzen Mischmasch aus offiziellen Empfängen, Besprechungen mit Inlands- und Auslandsgeheimdiensten, gehetzten Verhandlungen und Deklarationspapieren, Hoffnungen auf eine endlich gültige Strategievereinbarung, auf die nächste positive Evaluation oder sonst was. Und hier dagegen diese Sanftheit vor seinen Augen, welch ein Widerspruch. Warum hatte er „Ja!“ gesagt zur vorgeschlagenen Dienstreise? Seine Erinnerungen lösten sich auf, jetzt bemerkte er auch den Uringeruch, den der Wind mit sich trug. Er musste das Gebäude der Küstenwache finden beziehungsweise das der Schifffahrtsbehörde, oder wie auch immer die Kollegen sich hier nannten. Auf einem Papier hatte er sie als „Kompanie für maritime Sicherheit“, auf einem anderen als „Meeresgendarmerie“ gelistet gefunden, gemeint war wohl beide Male dieselbe Freiwilligenbrigade, die sich in der Stadt in den letzten Monaten formiert hatte. Man kam ja mit den vielen Namen ebenso durcheinander wie mit den neuen Gesetzen. Zurück auf der Küstenstraße verscheuchte er mehrere magere Katzen, die ihn mit gesträubtem Fell anfauchten und den Weg freimachten, um sich, sobald er vorbei war, wieder zusammenzurollen und zu Füßen der Mauer in Schatten zu verwandeln. Daniel war überrascht, als der Hafen vor ihm lag, leerstehende Imbissbuden, kleine Cafés, Fast-Food-Ketten, auf dem Uferbeton übereinandergestapelte Plastikstühle und Plastiktische, wie ineinander verkrochen; Tische um Tische gruppiert, Stühle um Stühle, als hätten sie sich von ihren früheren Ordnungen zu befreien versucht. Die Vitrinen und Fensterfronten der Bistros, Pubs und Restaurants glitzerten schon in der Morgensonne, überall lag Müll. Aus: Elena Messner: In die Transitzone, Edition Atelier, Wien, 2016. Elena Messner (*1983) ist Mitbegründerin der Kulturplattform www.textfeldsuedost.com, als Herausgeberin und Kulturvermittlerin tätig, schreibt Prosa, Essays und Theatertexte. Sie lebt derzeit in Marseille und unterrichtet am Institut für Germanistik an der Universität Aix-Marseille. Ihre Einführung in die „Postjugoslawische Antikriegsprosa“ ist 2014 bei Turia+Kant erschienen, ihr Debütroman „Das lange Echo“ im selben Jahr in der Edition Atelier und ihr zweiter Roman „In die Transitzone“ im Herbst 2016. online seit 31.05.2017 14:38:19 (Printausgabe 77) autorIn und feedback : Elena Messner |
|
Passagencollagen #2 Aus der Fassung gebracht [05.10.2018,Tortuga-Kollektiv] DIY-Punk gegen die Spaltung Die Debüt-LP von Lime Crush bringt musikalisch und personell einiges zusammen [03.10.2018,Bianca Kämpf] Eine Stimme für die Stimmlosen Sollte es in einer postpolitischen Phase so etwas wie politische Musik geben, dann war Grime seiner Sache um einige Jahre voraus [03.10.2018,Christoph Benkeser] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
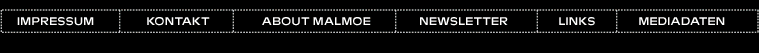 |