
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
„ ... ein Emigrant hat einen Buckel zu machen“ Österreich und die Exilliteratur Der Schriftsteller und Literaturwissenschafter Konstantin Kaiser ist Geschäftsführer der 1984 von ihm mitgegründeten Theodor Kramer Gesellschaft, die sich die Verbreitung der Literatur des Exils und des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus zur Aufgabe gemacht hat und unter anderem die Zeitschrift Zwischenwelt. Literatur/Widerstand/Exil. herausgibt. MALMOE hat ihn gebeten, die Arbeit der Theodor Kramer Gesellschaft vorzustellen und in die Beschäftigung mit der „österreichischen Exilliteratur“ einzuleiten. Der Aufsatz Bis die Erde das Gesicht der Liebe trägt … (Zwischenwelt 1–2/April 2017) der nun aus begreiflichen Gründen in Wien lebenden türkischen Menschenrechtsanwältin Şerife Ceren Uysal ruft mir in Erinnerung, dass Exil in autoritären Regimen immer zuerst eine Strafmaßnahme, die Verbannung an einen fernen Ort bedeutete, auf eine einsame Insel oder Küste, nach Sibirien oder Ostanatolien. Auch im Habsburger-Reich wurden z.B. tschechische Intellektuelle, die sich allzusehr für die nationalen Rechte der TschechInnen interessierten, in andere Reichsteile verbannt. Ganz anders verhält es sich mit jenem Exil, das durch Faschismus und Nationalsozialismus im Europa des 20. Jahrhunderts entstand. Über 400.000 spanische RepublikanerInnen, geschätzte 380.000 Deutsche, an die 150.000 in Österreich lebende Menschen, hunderttausende PolInnen, aus rassistischen und/oder politischen Gründen verfolgt, flüchteten, um dem Schlimmsten zu entgehen. Zum Teil wurden sie in den Gebieten und Ländern, in denen sie vorübergehend Zuflucht fanden, von ihren VerfolgerInnen wieder eingeholt – so in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, den sowjetisch besetzten Teilen Polens, in Ungarn … Auch freiwillig, aus Protest gegen die Zustände in ihrer Heimat, gingen etliche ins Exil, so der bayerische Schriftsteller Oskar Maria Graf, der allerdings, in Österreich angelangt, so vehement gegen die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 in Deutschland protestierte, dass eine Rückkehr ins „Reich“ für ihn nicht mehr möglich war. Oder Stefan Zweig: Nach einer Hausdurchsuchung im Juli 1934 hielt es ihn nicht mehr in Salzburg, im „Ständestaat“. Sein „freiwilliges“ Exil wandelte sich im März 1938, mit der Annexion Österreichs an das Deutsche Reich, in ein erzwungenes: Eine Rückkehr hätte von da an Gestapohaft, Konzentrationslager, Tod bedeutet. Sein Weltruhm hätte ihn so wenig geschützt, wie der Friedensnobelpreis von 1935 den deutschen Friedenskämpfer Carl von Ossietzky aus den Fängen der Gestapo befreite. „Ins Exil gegangen“ – die Redensart suggeriert, das „Exil“ sei irgendwo bereit gestanden; doch Exil ist auf keiner Landkarte eingezeichnet, es ist bloß die Daseinsform der Exilierten, die irgendwo legal oder illegal Zuflucht, Asyl, gefunden haben – oft mit Hilfe von Schleppern und Schlepperinnen, durch Bestechung, Dokumentenfälschung, Devisenschmuggel. Kaum dass 1938 die Massenflucht von Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich eingesetzt hatte, verschworen sich die potentiellen Aufnahmestaaten bei der Konferenz von Évian im Juli 1938 zur Verschärfung der Einreisebestimmungen und zur strengen Kontingentierung der Flüchtlingszahlen. An die Errichtung neuer Eiserner Vorhänge dachte man damals allerdings noch nicht. Wiederaufnahme unerwünscht Dem Lyriker Theodor Kramer gelang noch knapp vor Ausbruch des Weltkrieges die legale Ausreise; alle möglichen SchriftstellerkollegInnen, Thomas Mann, das englische PEN-Zentrum, die American Guild for German Cultural Freedom hatten sich für ihn eingesetzt, jetzt durfte er mit einem „permit“ für „domestic servants“ (Hausbedienstete) in England einreisen, wo er dann, kaum ein Jahr später, als „feindlicher Ausländer“ interniert wurde. Er schaffte die „Integration“, war 14 Jahre lang Bibliothekar an einem College in Guildford, ehe er 1957 nach Österreich zurückkehrte und 1958 in Wien starb. So wie für ihn, bedeutete Exil in jener Zeit für Hunderttausende in den „Gastländern“ oft langjährigen Aufenthalt in Arbeits- und Internierungslagern, ob in Kanada, Frankreich, Australien, China oder auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean. Kramer war der große lyrische „Chronist seiner Zeit“, einer, der „für die, die ohne Stimme sind“ schrieb, für die einfachen Soldaten des Ersten Weltkriegs in ihrem Leid, für die Dienstboten, Dorfarmen, Ziegel- und WanderarbeiterInnen, die böhmischen Knechte, schwangeren Bauernmägde, Vagabunden und slowakischen Auswanderer. Alle seine Gedichte, mit Ausnahme einiger früher, sind gereimt und schön in Strophen gegliedert. Man hat ihm darum Seitens österreichischer Nachkriegsgermanistik vorgeworfen, bloß Konventionelles, nichts Innovatives abgeliefert zu haben, ja sogar einer verdächtige Nähe zur völkischen Literatur geziehen. Und überhaupt – die ganze Exil- und Widerstandsliteratur sei formal konservativ geblieben, keine Spur von „Avantgarde“. Das führt zur Frage der österreichischen Exilliteratur. Unverhältnismäßig groß im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war die Anzahl der aus Österreich vertriebenen SchriftstellerInnen; ungefähr jede/r zweite literarisch Tätige in Österreich war für den Nationalsozialismus nicht „kompatibel“. Obwohl AutorInnen meist an ihre Sprache gekettet sind wie Prometheus an den Felsen, kam nur ein kleinerer Teil der ExilschriftstellerInnen nach Österreich zurück. Denn erstens wollte Österreich von den Exilierten nichts wissen, ob sie nun musizierten, Gesetze auslegten, das Stethoskop oder die Feder gebrauchten. Und zweitens hatten die Exilierten mittlerweile erfahren, was mit ihren im Land zurückgebliebenen Großmüttern, Tanten, Eltern, Freunden geschehen war, mit Zutun und lautstarker und stillschweigender Billigung so vieler, und scheuten sich, diese blutgetränkte Erde wieder zu betreten. Die AutorInnen schrieben auch nach 1945 vielfach weiter in deutscher Sprache, suchten demgemäß Kontakte in Österreich. Physisch fern, strebten sie nach geistiger Wiederaufnahme, die nicht stattfand. Theodor Kramer resümierte 1955: „In Österreich scheint man Rückkehr als Bedingung zu stellen dafür, daß man Notiz nimmt von meinem Werk. Daß Österreich eine eigene Diktatur hatte und an der Naziherrschaft nicht unschuldig war, davon will man durchaus ganz und gar überhaupt nichts mehr hören, ein Emigrant hat einen Buckel zu machen.“ Kontinuitäten nach 1945 und die (Wieder)Entdeckung des Exils Nach meiner und nicht nur meiner Auffassung war die österreichische Nachkriegsordnung strukturell antisemitisch. Das bedeutete zum einen, dass man das antisemitische Ressentiment (welches in den ersten Nachkriegsjahren vielfach noch ganz unverschämt geäußert wurde) zunehmend an diese Ordnung delegieren konnte, bis hin zu der paradoxen Realität eines „Antisemitismus ohne Antisemiten“. (Allzu tief kratzen durfte man aber nicht.) Das bedeutete zum anderen, dass man sich auch dann, wenn man sich von den Gräueln des Nationalsozialismus distanzierte, mit seinen Hinterlassenschaften abfand, und das wiederum bedeutet vor allem: sich damit abzufinden, dass das Exil – sowohl die Exilierten selbst als auch ihre Werke – in Österreich weiterhin diffamiert, herabgewürdigt, totgeschwiegen wurden. Auch um diesen strukturellen Antisemitismus – der seine Auswirkungen auf alle kulturellen Bereiche hat – zu durchbrechen, wurde 1984 die Theodor Kramer Gesellschaft gegründet. Sie war nicht die einzige Initiative auf diesem Gebiet; schon das 1963 gegründete Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands hatte mit der Sammlung von Dokumenten und Zeitschriften des Exils begonnen, das Institut Wiener Kreis forschte zur Wissenschaft im Exil, die Österreichische Gesellschaft für Literatur lud ExilschriftstellerInnen immer wieder zu Lesungen ein, die Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, seit 1993 auch Herberge der Österreichischen Exilbibliothek, veröffentlichte vereinzelt Publikationen zu ExilschriftstellerInnen, so auch den von mir 1983 herausgegebenen Band Theodor Kramer 1897 – 1958. Dichter im Exil. Alles in allem muss man aber feststellen, dass ein breiteres Interesse an dem so lange vernachlässigten Thema erst in den frühen 1980er Jahren – also vor Waldheim – aufgekommen ist. Das Exil wurde nun nicht mehr bloß als eine Frage der Betroffenen und ihrer Nachkommen gesehen, sondern als ein Problem von allgemeiner Relevanz. Unter in Österreich lebenden SchriftstellerInnen wurde es Mode, sich, wenn nicht im Exil zu sein, so doch im Exil zu fühlen. Man bemächtigte sich auch literarisch des Stoffes; mit einem Mal tauchten Exilierte in den Romanen von AutorInnen der Gegenwart auf. Einschlägige Studien universitärer WissenschaftlerInnen blieben dennoch lange Jahre Mangelware. Und das offizielle Österreich hinkte hinten nach und hat bis heute nicht damit aufgehört. Wird es je in Österreich ein Institut für Exilforschung geben oder gar ein „Haus des Exils“, das die Nobelpreisträgerin Herta Müller für Deutschland forderte und das in Österreich ebenso fehlt wie in der BRD? Dafür haben wir, hochsubventioniert, seit 1996 ein „Haus der Heimat“ in Wien für die „volksdeutschen“ Vertriebenenverbände. Das seit Jahrzehnten alle paar Jahre wiederholte Wort vom „Schlussstrich“, der zu ziehen wäre, macht wieder die Runde, während die Ausgrabungen in Ephesos hoffentlich doch weitergehen. Zum Wirken der Theodor Kramer Gesellschaft Immerhin, in den bald 35 Jahren ihres Bestehens ist der Theodor Kramer Gesellschaft einiges gelungen: Die Zeitschrift Zwischenwelt, eine, wie der ehemalige Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka einmal pointierte, „moderne Ausgrabungsfabrik mit Vergangenheit und Zukunft“; die Etablierung des Theodor Kramer Preises für Schreiben im Widerstand und im Exil, der seit 2001 alljährlich vergeben wird; die Verlagstätigkeit mit mittlerweile über 70 Titeln; der Aufbau eines Archivs, das auch der Rettung sonst wahrscheinlich unwiederbringlicher Zeugnisse und Schriften des Exils dient. Wichtig scheinen mir ebenso die Symposien, die die Gesellschaft veranstaltet, meist zu Themen, die zu wenig Beachtung fanden, so z.B. 2014 Die Zerstörung der Arbeiterkultur durch Faschismus und Nationalsozialismus. Diese Tagung zeigte, dass die Arbeiterkultur zunächst nicht durch die sanfte Gewalt des sozialen Wandels marginalisiert wurde, sondern durch gezielte Repression, einschließlich der Ermordung und Vertreibung vieler ProtagonistInnen. Heuer, im November 2017, laden wir zu einer Tagung zur Autobiographik von Exil, Widerstand, Verfolgung und Lagererfahrung, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Was von den NationalsozialistInnen Verfolgte und Exilierte aufzeichneten, soll gewürdigt und genützt werden. Anders als bei den vielen Video-Interviewfilmen, bei denen allzu oft die gleichen Standardfragen gestellt werden, zeichnen die schriftlichen Zeugnisse ein viel komplizierteres, differenzierteres Bild von Verfolgung und Flucht, von Überleben im Exil. Möglicherweise muss man diese Zeugnisse als eine neue literarische Gattung betrachten – sie unterscheiden sich inhaltlich sehr deutlich von dem, was zuvor in Autobiographien Gegenstand des Erinnerns und Rechtfertigens war. Sie machen unserer Vorstellung die – wenn auch beengten – Handlungsspielräume unter den Bedingungen des Terrors zugänglich, reden von der Freiheit, die man sich nehmen konnte, also vom Leben. Von Konstantin Kaiser erschien zuletzt der Gedichtband KindheitsZyklus (Kultur Spur Verlag, 2016). Am 22. Mai stellt die Theodor Kramer Gesellschaft im Jüdischen Museum der Stadt Wien zwei neue Bände der Reihe Nadelstiche vor: Jiddische Lyrik sowie Gedichte und Chansons der Shoah-Überlebenden Tamar Radzyner. www.theodorkramer.at online seit 10.05.2017 18:31:13 (Printausgabe 78) autorIn und feedback : Konstantin Kaiser |
|
Passagencollagen #2 Aus der Fassung gebracht [05.10.2018,Tortuga-Kollektiv] DIY-Punk gegen die Spaltung Die Debüt-LP von Lime Crush bringt musikalisch und personell einiges zusammen [03.10.2018,Bianca Kämpf] Eine Stimme für die Stimmlosen Sollte es in einer postpolitischen Phase so etwas wie politische Musik geben, dann war Grime seiner Sache um einige Jahre voraus [03.10.2018,Christoph Benkeser] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
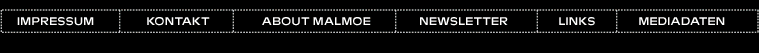 |