
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
„Wir sind Sprachwandler“ Die AutorInnen Sarita Jenamani und Aftab Husain im Gespräch über ihr Schreiben und ihr Exil Die Schriftstellerin und Wirtschaftswissenschafterin Sarita Jenamani aus Indien und der Literaturwissenschafter, -kritiker und Lyriker Aftab Husain aus Pakistan sind 2003 über das Stipendienprogramm Wien als Zufluchtstadt nach Wien gekommen. Neben Ihrer Arbeit als SchriftstellerInnen und WissenschafterInnen sind sie auch als ÜbersetzerInnen tätig. 2016 gründeten sie die mehrsprachige Online-Literaturzeitschrift WORDS & WORLDS / WÖRTER & WELTEN. MALMOE hat mit ihnen über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen als AutorInnen im Exil gesprochen. MALMOE: Sie sind vor über 13 Jahren gemeinsam von Indien nach Europa gekommen. Haben Sie sich ganz bewusst für Wien als den Ort ihres Exils entschieden? Aftab Husain: Nein, das war nicht meine Entscheidung, das war das Schicksal bzw. der Zufall. Ich wollte mein Land nicht verlassen. Ich musste ins Exil gehen, um mein Leben zu retten. Und es war mehr oder weniger reiner Zufall, dass ich zuerst nach Deutschland und dann nach Wien gegangen bin. Sarita Jenamani: Weil Aftab politisch aktiv gewesen ist, sich am Friedensprozess zwischen Indien und Pakistan beteiligt und den Gedichtband des damaligen indischen Premierministers übersetzt und in seinem Verlag herausgegeben hatte, musste er nach dem Militärputsch (1999, Anm. d. Red.) Pakistan verlassen. Wir konnten weder in Indien noch in Pakistan leben. Unsere Entscheidung war, dass wir gemeinsam leben wollen und das war nur möglich indem wir in ein drittes Land gehen. Unter welchen Umständen sind Sie geflüchtet und wie sind Sie schließlich nach Wien gekommen? SJ: Als Aftab in Indien war und von beiden Ländern, also Indien und Pakistan, verfolgt wurde, wurde seine Geschichte in der britischen Tageszeitung The Independent veröffentlicht und dadurch PEN-Deutschland aufmerksam auf seinen Fall. AH: Ja, es war dann weltweit bekannt, dass ich gewissermaßen zwischen zwei Staaten stand und mein Leben in Gefahr war. SJ: Und da haben wir zunächst das Angebot von PEN-Deutschland angenommen und sind dann über das mit dem Writers in Exile-Netzwerk verbundene Stipendium Wien als Zufluchtsstadt der IG Autorinnen Autoren und der IG Übersetzerinnen Übersetzer hierher gekommen. Welche Erfahrungen haben Sie als AutorInnen im Exil gemacht und inwiefern haben diese Erfahrungen Ihre literarische Arbeit beeinflusst? AH: Ich musste mein Land plötzlich verlassen, ich hatte das nicht vorhergesehen. Im Unterschied dazu, freiwillig in ein anderes Land zu ziehen oder zu reisen, ist das Exil mit großem Druck verbunden. Ich habe mich inzwischen intensiv mit Themen des Exils beschäftigt. Wie gehst du damit um, wenn du keine Sprache und keine Leserschaft mehr hast? Das ist ein großes Problem. In meinen neuen Büchern und Gedichten kann man diese Beschäftigung vielleicht erkennen. SJ: Das kulturelle Milieu, die Sprache, die Literatur, die dir bekannt ist – das alles ist plötzlich weg. Das ist zum Beispiel bei MalerInnen anders, sie haben eine universale Sprache. Aber SchriftstellerInnen sind im Exil nicht nur ihrer Familie, ihrer Kultur, ihres Landes beraubt, sondern sie verlieren auch ihre Sprache. Ich spreche hier einzig mit meinem Sohn in meiner Muttersprache Oriya, eine regionale Sprache Indiens, und habe aber vorher hauptsächlich auf Oriya und Hindi geschrieben. Und im Gastland hat man meist nicht die Möglichkeit publiziert zu werden. Alle wollen sofort, dass du integriert bist, also auf deutsch schreibst – das finde ich einen lächerlichen Anspruch. Es ist etwas anderes, eine Sprache zur Kommunikation im Alltag zu benutzen, als sie für das Schreiben, einen kreativen Prozess, zu nutzen. Gleichzeitig erweitert das Exil aber auch den eigenen intellektuellen Horizont. Jede Sprache denkt anders und nimmt die Gefühle und Dinge anders wahr. Ich denke, ExilautorInnen haben Nachteile, aber auch Vorteile: in dem Sinn, als dass sie sich zwischen den Kulturen bewegen. Aber ja, dieser Druck, sich sofort zu integrieren, sofort in der Sprache des neuen Landes zu schreiben, das ist ein großes Thema. AH: Ja, wie für alle anderen ExilschriftstellerInnen gibt es auch für mich Vor- und Nachteile. Ich vermisse mein früheres Heimatland, aber ich fühle mich auch hier sehr zu Hause. Es gibt viele neue Möglichkeiten für mich. Außerdem habe ich Freunde und Familie hier. Mein Sohn wurde hier geboren und seine Sprache ist Deutsch. Er ist zu Hause in dieser Sprache. Ich fühle mich also auch durch ihn mit Österreich verbunden. Von ExilschriftstellerInnen wird oft erwartet, dass sie, weil sie im Exil sind, über Nostalgie, die Vergangenheit und Ähnliches schreiben. Die AutorInnen werden auf das Thema des Exils reduziert. Es sind aber nicht nur diese Thematiken, die LiteratInnen im Exil beschäftigen. Man kann sich beispielsweise auch mit sozialen und politischen Gegebenheiten hier auseinandersetzen. Ein weiterer Punkt ist, dass das Thema Exil sehr unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Es geht nicht immer nur um einen Blick zurück, sondern auch darum, mit neuen Impulsen zu arbeiten. Ich habe mich letztes Jahr mit dem Vergleich zweier Kulturen beschäftigt, indem ich eine Reihe von Gedichten über Wien und meine Heimatstadt Lahore geschrieben habe. Wenn ich hier durch den ersten Bezirk gehe, denke ich immer an Lahore, es gibt durchaus Ähnlichkeiten. Ich habe also meine Wahrnehmungen hier in einen Zusammenhang mit Lahore gestellt. Man kann künstlerisch sehr vielfältig mit der Exilerfahrung umgehen. Sie schreiben beide in mehreren Sprachen und sind auch ÜbersetzerInnen. Welche Bedeutung hat dieses Sich-Bewegen zwischen mehreren Sprachen für Sie und Ihre Arbeit? AH: Wir sind in mindestens drei, vier Sprachen beheimatet. In Pakistan und Indien ist es wie in vielen postkolonialen Ländern ganz normal, mehrsprachig zu sein. Viele schreiben Lyrik oder kreative Texte in ihrer eigenen Sprache und wissenschaftliche Texte auf Englisch, um ein internationales Publikum zu erreichen. Und wenn ich zum Beispiel ein schönes Gedicht auf Deutsch lese und es mit meinen Freunden teilen will, die nicht Deutsch sprechen, dann übersetze ich es. SJ: Ja, wir sind sozusagen Sprachwandler. Ich empfinde es als einen großen Vorteil, in mehreren Sprachen schreiben zu können. Jede Sprache und ihre Vorgehensweise, ihre Art, die Dinge zu betrachten, ist unterschiedlich. Und beim Übersetzen lernt man sehr viel, bekommt neue Impulse. Man setzt sich intensiv mit den Texten und den AutorInnen auseinander und fragt sich: Wie hat dieser Mensch gedacht? Dabei lernst du, das Leben von einem anderen Blickwinkel aus zu sehen. Ich habe zum Beispiel auch Gedichte von Rose Ausländer, die mehrmals in ihrem Leben fliehen musste, übersetzt. Deutschland und Österreich haben eine starke Exilliteratur. Selbstverständlich frage ich mich, wie es diesen Leuten gegangen ist. Wie sie mit dieser Situation umgegangen sind und wie sie das in ihrem Schreiben reflektieren – dabei hilft mir das Übersetzen. Außerdem denke ich auch, dass es, da wir aus einem anderen kulturellen Umfeld kommen, aber hier wohnen, unsere Aufgabe ist, als kulturelle Brücke zu arbeiten. Es gibt so viele Missverständnisse und wenn man Literatur übersetzt, dann ist das ein Beitrag dazu, diese Missverständnisse aufzulösen. Sind das Übersetzen und das Fungieren als „kulturelle Brücke“ daher für Sie auch eine bewusste politische Entscheidung? SJ: Das ist eine menschliche Entscheidung. Hier leben jetzt tausende Leute, die aus verschiedenen Gründen flüchten mussten. Wo sind sie zugehörig? Wenn man zum Beispiel von „SchriftstellerInnen aus Österreich“ spricht, zählt man uns da dazu? Wir wohnen hier, wir arbeiten hier. Wenn ich sage, wir „müssen“ als kulturelle Brücken arbeiten, dann geht es dabei um Menschlichkeit, nicht um etwas Politisches. Als AutorInnen arbeiten wir, damit man uns wahrnimmt, damit wir nicht bloß als Zahlen wahrgenommen werden. Wir denken, wir schreiben, wir tragen etwas zur Gesellschaft bei und das muss anerkannt werden. Sind das auch die Gründe, die Sie dazu bewogen haben, die Zeitschrift WORDS & WORLDS / WORTE & WELTEN herauszugeben? SJ: Ja. Wir schätzen uns glücklich, weil wir über das Writers in Exile-Programm hierhergekommen sind. Unsere Arbeiten sind übersetzt und auch auf Deutsch veröffentlicht worden. Aber wie viele Leute haben diese Chance? Die Idee, die Zeitschrift zu gründen hatten wir 2015, während der sogenannten Flüchtlingskrise. Es war auffällig, dass immer nur von Zahlen gesprochen wurde, so und so viele Leute sind gekommen. Aber es sind eben so und so viele Leute mit so vielen Geschichten gekommen. AH: Und auch Sichtweisen, so und so viele unterschiedliche Sichtweisen. SJ: Ja, und wenn wir ihnen keine Möglichkeit bieten, gehört zu werden, was passiert dann mit ihnen? Sie sind da, sie bleiben da, sie müssen gehört und integriert werden. Und integriert werden heißt nicht, dass du einen dreimonatigen Deutschkurs machst. Integriert sein muss heißen, dass du fühlst, dass du Teil dieser Gesellschaft bist, dass du akzeptiert wirst. Literatur kann dabei eine große Rolle spielen, denn sie spricht zu unseren Herzen. Sie ist ein wirkungsvolles Instrument, das man benutzen kann, aber dazu braucht man Möglichkeiten. Wir haben nicht dieselben Rahmenbedingungen wie nicht-migrantische AutorInnen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns vernetzen, auch mit AutorInnen ohne migrantischen Hintergrund. Alle Texte in der Zeitschrift erscheinen in der Sprache, in der sie geschrieben wurden und in einer Übersetzung auf Deutsch oder Englisch. AH: Die Situation von AutorInnen, die nicht auf Deutsch schreiben, hat uns sehr beschäftigt. Viele von Ihnen schreiben seit Langem hier, sind aber vollkommen unbekannt. Sie werden von niemandem gelesen und gehört. Manche haben vielleicht irgendwo ein paar Gedichte oder Kurzgeschichten veröffentlicht, aber es gibt kaum bis keine staatliche Unterstützung für Übersetzungen oder Förderungen und Preise für diese SchriftstellerInnen. WORDS & WORLDS / WORTE & WELTEN ist auch ein Versuch, dazu beizutragen, dass ihre Stimmen nicht verlorengehen. WORDS & WORLDS / WORTE & WELTEN. An Austrian Bilingual Magazin for Migrant Literature / Eine bilinguale österreichische Zeitschrift für MigrantInnenliteratur: www.wordsandworldsmagazine.com online seit 10.05.2017 18:31:18 (Printausgabe 78) autorIn und feedback : Interview: Katharina Menschick, Philipp Sperner |
|
Passagencollagen #2 Aus der Fassung gebracht [05.10.2018,Tortuga-Kollektiv] DIY-Punk gegen die Spaltung Die Debüt-LP von Lime Crush bringt musikalisch und personell einiges zusammen [03.10.2018,Bianca Kämpf] Eine Stimme für die Stimmlosen Sollte es in einer postpolitischen Phase so etwas wie politische Musik geben, dann war Grime seiner Sache um einige Jahre voraus [03.10.2018,Christoph Benkeser] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
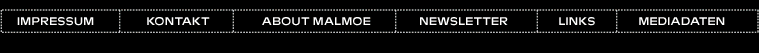 |