
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
Ein Ort der aktiven Erinnerung Die Österreichische Exilbibliothek im Literaturhaus Wien Die vierteilige Literatur-Serie Koordinaten entstand in Kooperation mit Veronika Zwerger, der Leiterin der Österreichischen Exilbibliothek im Literaturhaus Wien, und Thomas Ballhausen, der für die dortige Pressedokumentationsstelle zuständig ist. MALMOE hat die beiden besucht und sich von der Geschichte, den Aufgaben und den Intentionen der Sammlung zum Exil, aus der die in den Koordinaten veröffentlichten Werke stammen, erzählen lassen. Bereits das Gebäude, in dem sich heute das Literaturhaus Wien und mit ihm die Exilbibliothek befinden, ist historisch mit der Thematik der Sammlung verbunden: Von 1945 bis 1955 wurde im Haus in der Seidengasse 13 von den US-amerikanischen Behörden der Radiosender Rot-Weiß-Rot betrieben, der zur „Re-education“ und Demokratisierung der ÖsterreicherInnen beitragen sollte. An der Programmgestaltung waren auch zurückgekehrte ExilantInnen wie Gerhard Bronner und Marcel Prawy beteiligt. Ein Teil der Sammlung der Exilbibliothek ist heute im ehemaligen Luftschutzkeller des Hauses untergebracht. Die Regale stehen dort eng nebeneinander, in den Kartonschachteln darauf befinden sich die nach ihren VerfasserInnen und AdressatInnen geordneten Manuskripte, Briefe und persönlichen Dokumente. So zum Beispiel auch Eintrittskarten zu kulturellen Veranstaltungen im Wien der späten 1920er und frühen 1930er-Jahre, die die gelernte Röntgenassistentin Hanna Kuh mit ins Exil nach England genommen hatte. Die Sammlung umfasst zudem auch zahlreiche nicht-papierne Gegenstände wie die Hutsammlung der Autorin und Hutmacherin Mimi Grossberg. Vielfältige Exilerfahrungen Insgesamt befinden sich heute die (Teil)Nachlässe von etwa 100 ab 1933/38 aus Deutschland und Österreich vertriebenen bzw. emigrierten Personen im Literaturhaus. Ihre Gründe ins Exil zu gehen und die Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind zum Teil sehr unterschiedlich. So überlebte Hanna Kuh (Koordinaten #3), die als Jüdin von den NationalsozialistInnen verfolgt wurde, durch ihren Gang ins Exil als einzige ihrer Familie die Shoa. Nach ihrer Flucht arbeitete sie unter anderem als Dienstmädchen. Elisabeth Janstein (Koordinaten #1) wiederum emigrierte, da die reichsdeutschen Redakteure zunehmend in ihre journalistischen Texte eingegriffen hatten. Es gelang ihr nicht, im Exil als Journalistin oder Schriftstellerin wieder Fuß zu fassen. Eine der Besonderheiten der Exilbibliothek besteht darin, dass sie ihrer Arbeit explizit einen breiten Literaturbegriff zu Grunde gelegt hat. Thomas Ballhausen weist darauf hin, dass alles andere hieße „zu antizipieren, was in 50 Jahren vielleicht immer noch spannend sein wird oder dann spannend geworden ist. Und das wäre eine Vermessenheit, die man sich als Archivarin, als Archivar eigentlich nicht erlauben darf.“ So werden auch Nachlässe von Personen gesammelt und zugänglich gemacht, die nicht explizit schriftstellerisch tätig waren sowie von AutorInnen, deren Werke zu Lebzeiten nicht veröffentlicht wurden, was oftmals auch direkt mit ihrer Exilerfahrung zusammenhing. Ihre autobiografischen und weiteren persönlichen Zeugnisse geben Einblicke in den Alltag im Exil und dokumentieren ihn über die Möglichkeiten explizit literarischer Werke hinaus. So finden sich im Nachlass von Hanna Kuh zum Beispiel auch die fünf vermutlich einzig noch erhaltenen Ausgaben der Zeitschrift Österreicherin im Haushalt, die von der Gemeinschaft der österreichischen Hausgehilfinnen ab 1939 in England herausgegeben wurde. Auszüge daraus werden in den Koordinaten #3 zu lesen sein. Die Bibliothek als Ort der aktiven Erinnerung Den Großteil der Dokumente und Gegenstände seiner Sammlung hat die Exilbibliothek von jenen, denen sie einst gehörten bzw. später von ihren Familienangehörigen geschenkt bekommen. Der Kontakt zu den aus Österreich Geflüchteten war von Beginn an eines der zentralen Anliegen der 1993 eingerichteten Institution. Der Gründung vorausgegangen war die Ausstellung Die Zeit gibt die Bilder – Schriftsteller, die Österreich zur Heimat hatten, die von der späteren Leiterin der Exilbibliothek Ursula Seeber und der Fotografin Alisa Douer gestaltet worden war. Douer hatte auf der ganzen Welt über 70 AutorInnen und KünstlerInnen, die vertrieben worden waren, porträtiert. Für viele von ihnen war die Einladung zur Ausstellungseröffnung 1992 die erste offizielle Kontaktaufnahme aus Österreich nach ihrer Flucht. Bis heute ist die Exilbibliothek eine Anlaufstelle für die Familien jener, deren Nachlässe hier restauriert, geordnet und zugänglich gemacht werden. Die Sammlung richtet sich daher nicht ausschließlich an ein (wissenschaftlich) interessiertes Publikum, sondern ist auch für die Familien der Exilierten ein Ort, an dem sie Zugang zu den Lebensgeschichten ihrer Verwandten finden können. Die bio-bibliografische Datenbank zur Sammlung umfasst zwar über 7000 Einträge, zu manchen Personen sind allerdings nur sehr wenige Informationen vorhanden. Viele ihrer biografischen Spuren sind im Exil oder auf dem Weg dorthin verloren gegangen. So erzählt Veronika Zwerger beispielsweise, dass sie über Kurt Weinbergs Leben vor und nach seiner Flucht nach Palästina, die er in seinem Tagebuch dokumentiert hat – Auszüge daraus werden in den Koordinaten #4 veröffentlicht –, trotz aufwendiger Recherchen nur sehr wenig herausfinden konnte. Eine Sammlung, die entdeckt werden will Vieles aus den Beständen ist bis heute nicht publiziert und somit auch von einer breiteren Öffentlichkeit unbeachtet. Daher liegt ein expliziter Fokus der Arbeit der Exilbibliothek in der Sichtbarmachung der Bestände und der Vermittlung dessen, wovon sie erzählen. Neben zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und der Veröffentlichung von Publikationen unterstützen die MitarbeiterInnen auch Diplomarbeitsprojekte und bieten Workshops für SchülerInnen an. Auch die Koordinaten wollen dazu beitragen, die im kollektiven Gedächtnis noch immer allzu oft verdrängten Erfahrungen jener, die ins Exil gezwungen wurden, in aktive Erinnerung zu rufen. Die Sammlungen der Österreichischen Exilbibliothek sind nach Voranmeldung öffentlich zugänglich. www.literaturhaus.at www.exilbibliothek.wien/ online seit 10.05.2017 18:31:04 (Printausgabe 78) autorIn und feedback : Katharina Menschick, Philipp Sperner Links zum Artikel:
|
|
Passagencollagen #2 Aus der Fassung gebracht [05.10.2018,Tortuga-Kollektiv] DIY-Punk gegen die Spaltung Die Debüt-LP von Lime Crush bringt musikalisch und personell einiges zusammen [03.10.2018,Bianca Kämpf] Eine Stimme für die Stimmlosen Sollte es in einer postpolitischen Phase so etwas wie politische Musik geben, dann war Grime seiner Sache um einige Jahre voraus [03.10.2018,Christoph Benkeser] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
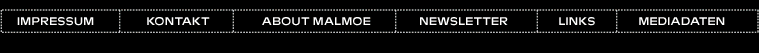 |