
 |
| |
|
|
||||
| |
||||||
|
Die Schule versagt beim Exil Die (Nicht-)Behandlung des Exils im Literaturunterricht zeigt, wie wenig die Schullandschaft mit komplexen und potentiell kontroversen Thematiken umgehen kann Der Kanon und das Exil Der literarische Kanon gilt als inoffizielle Vereinbarung in einer Gesellschaft, die Auskunft darüber gibt, welche Werke besonders „gut“, „schön“ oder „wichtig“ sind. Die Schule ist die wohl sedimentierteste Form eines solchen Bewusstseins. Obwohl es an Österreichs Schulen schon lange keinen verpflichtenden Werkkanon mehr gibt, nimmt die Auseinandersetzung mit Literatur als wesentliches Medium eines kollektiven Gedächtnisses im Lehrplan prominenten Stellenwert ein. In der Schule wird täglich verhandelt, was eine Gesellschaft nicht nur als lesens-, sondern auch als lehrenswert betrachtet. Das Exil ist nicht einfach zu begreifen. Es fordert festgesetzte Grenzen der Erinnerung heraus. Es mag uns so einige Antworten auf Lebensfragen geben, aber Jean Amérys Erkenntnis, dass „es keine Rückkehr gibt“, weil „niemals der Wiedereintritt in einen Raum auch ein Wiedergewinn der verlorenen Zeit ist“, stellt den Kanon zunächst vor eine Herausforderung. Wie kann ein unwiederbringlicher Verlust seinen verdienten Stellenwert überhaupt wiedererlangen? Das Exil darf in die Schule, aber durch die Hintertür bitte! Eine genauere Analyse der entscheidenden Institutionen, die über den impliziten Schulkanon bestimmen, erbringt leider selbst heute noch ernüchternde Ergebnisse: Das Exil wird in den österreichischen Lehrplänen unter dem Schlagwort „Multikulturalität“ abgehandelt, um nicht zu sagen abgetan. Die vertriebenen Jüd_innen und Antifaschist_innen werden damit als die kulturell „Anderen“ konstruiert und aus dem Umfeld des kulturell „Eigenen“ ausgeschlossen. Sie werden in der Formulierung des Lehrplans einerseits zur Tür gewiesen und andererseits eingeladen, doch bitte freundlicherweise durch die Hintertür der „Multikulturalität“ wieder einzutreten. Trotz einiger positiver Beispiele, muss bei einer Analyse der aktuell verfügbaren Schulbücher für den Deutschunterricht an der nüchternen Feststellung des Germanisten und Literaturwissenschaftlers Johann Holzner von 1975 festgehalten werden: Der Kanon ist von Ausschlusslogiken geprägt, Exilschriftsteller_innen finden kaum Platz. Jene, die erwähnt werden, fallen einer „werkimmanenten Literaturauffassung“ zum Opfer. So wird beispielsweise die jüdische Exilantin Anna Seghers kommentarlos neben dem frühen NS-Sympathisanten Gottfried Benn unter der Rubrik „Vertreter des Expressionismus“ eingereiht. Wer nach möglichen Gründen für solch fundamentale Verquerungen sucht, wird schnell fündig. Es gibt keine einzige Professur für Exilforschung an Österreichs Universitäten. Die „unangenehme“ Aufgabe, Österreichs Geschichte der Vertreibung zu beleuchten, bleibt kleinen und meist prekären Forschungseinrichtungen überlassen. Ein kritisches Bewusstsein über den Kanon müssen sich angehende Lehrende auf Eigeninitiative über informelle Kanäle aneignen. Die „kompetenzorientierte Zentralmatura“ Durch die Reform der Zentralmatura bleibt der Literaturkanon an sich weiterhin für die individuelle Gestaltung der Lehrenden geöffnet. Diese sind jedoch vermehrtem Druck ausgesetzt, ihre Schüler_innen auf standardisierte Examen vorzubereiten, und dafür gibt es klar bestimmte Anforderungen. Im Mittelpunkt stehen „Problemlösungskompetenzen“, die mittels definierter „Operatoren“ klar angesprochen und erreicht werden sollen. Welche Operatoren sich für welchen Text eignen, wird durch den neuen „Kanon der Textsorten“ bestimmt. Die Fähigkeit zur Kritik kommt quasi im Katalog. Gefordert wird, dass pro Aufgabe möglichst nur ein Operator verwendet werden sollte. „Erörtern“ verdrängt das „Argumentieren“ und das „Vergleichen“ scheint auch ohne „Analyse“ stets schon abgeschlossen. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass eine derart komplexe Thematik wie jene des Exils kaum vorkommen kann. Texte werden vor allem nach formalen Kriterien ausgewählt. So waren die Schüler_innen bei der Matura 2014 dazu aufgerufen, einen Text von Manfred Hausmann, Erfolgsautor im Dritten Reich, zu „deuten“ – ohne dafür nähere Informationen über den Entstehungskontext des Werkes in der Aufgabenstellung zu finden. Das Exil als Chance Jedoch gerade die Beschäftigung mit dem Exil zeigt sich als fruchtbar für die Herausbildung eines mündigen Bewusstseins. Exilliteratur stellt die Sinnhaftigkeit eines von Geschichte und Politischer Bildung abgekoppelten Literaturunterrichts in Frage. Das Exil in der Literatur konfrontiert mit Biographien, die lange Zeit aus dem „kulturellen Gedächtnis“ verbannt worden waren, und hinterfragt somit das Fundament eines Kanons an sich. Die erschreckend naheliegenden Analogien zu aktuellen Geschehnissen im Bereich Flucht und Asyl bedürfen eines historischen Fundaments und einer kritischen Empathiefähigkeit, die sich sicherlich nicht aus der einen oder anderen „Kompetenz zur Problemlösung“ ergibt. Die Beschäftigung mit dem Exil könnte auch ein neues Licht auf die Geschichte der Schule werfen: Der Pädagoge, Psychoanalytiker und Mitbegründer der Jugendforschung Siegfried Bernfeld und der Pädagoge, Sozialist und Wiener Gemeinderat Ernst Papanek entwickelten vor ihrer Vertreibung aus Österreich eine innovative Pädagogik, nach welcher Schüler_innen gesellschaftlichen Realitäten nicht entfliehen, sondern sich mit ihnen vertraut machen sollten, um soziale Spannungen, gesellschaftliche Widersprüche und Konflikte auszuhalten. Eine solche innovative Pädagogik, die erst im Begriff war, ihr Ethos zu entwickeln, fiel dem NS-Terror zum Opfer und musste einem Erziehungsverständnis Platz machen, nach dem sich die Schule an das „Volkstum“ anzupassen hatte. Die Theodor Kramer Gesellschaft und der Verein zur Förderung und Erforschung antifaschistischer Literatur haben 2015 einen ersten Versuch gestartet, das Thema Exilliteratur für die Verwendung im Unterricht aufzuarbeiten. Trotz vieler unterstützender Hände zeigte sich auch hier wie vermeintlich „ungeeignet“ das Thema Exil für die Verwendung in der Schule ist. Es fand sich kein Schulbuchverlag, der bereit gewesen wäre, die Unterlagen unter den jetzigen Umständen am Markt zu drucken: zu spezifisch und zu wenig lukrativ. Nach wohlwollenden Beratungen wurde auch diesem Projekt die Tür gewiesen. Judith Aistleitner, Laurin Lorenz, Thomas Wallerberger (Hg.): Grenzüberschreitungen: Didaktische Materialien zur Exilliteratur, Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, Wien 2015 online seit 10.05.2017 18:30:56 (Printausgabe 78) autorIn und feedback : Laurin Lorenz |
|
Passagencollagen #2 Aus der Fassung gebracht [05.10.2018,Tortuga-Kollektiv] DIY-Punk gegen die Spaltung Die Debüt-LP von Lime Crush bringt musikalisch und personell einiges zusammen [03.10.2018,Bianca Kämpf] Eine Stimme für die Stimmlosen Sollte es in einer postpolitischen Phase so etwas wie politische Musik geben, dann war Grime seiner Sache um einige Jahre voraus [03.10.2018,Christoph Benkeser] die nächsten 3 Einträge ... |
||||
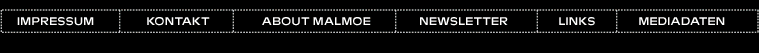 |